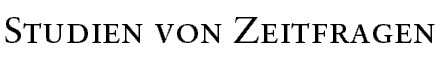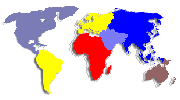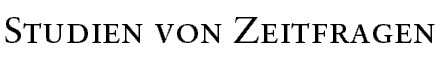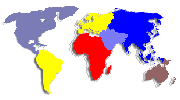|
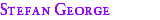
6.
Ahnung gesellt mich zu euch
Kinder des Inselgebiets
Die allgemeine Bildung, die verfluchte humanistische Bildung erschien George und den Seinen als ein Krebsübel des 19. Jahrhunderts. „Dieser zeit des allwissens“, haben ganz in
Georges Sinn die Herausgeber des „Jahrbuchs“ festgestellt, wird einmal der vorwurf nicht erspart bleiben daß keine andre, auch nicht die des krassesten aberglaubens so vollkommen platt, von
allem wirklichen wissen so vollkommenen entfernt war.” Gegen diese vermeintliche „Wissensverachtung lehnte sich Max Weber auf und herrschte uns einmal mit der Frage an: „Wollen Sie
eigentlich Banausen züchten?“ Gundolf erwiderte: „Nein, freie Menschen“. Worauf Max Weber: „Das ließe ich mir gefallen. Aber das Produkt sind nur blasse Humanisten.“
Als wir dem Meister von der Wechselrede berichteten, kam es zum ersten Gespräch über den Sinn des Humanismus. Manche sind nach dem Krieg gefolgt. Ihre Richtung war verschieden; in
Gundolfs und Hellingraths Anwesenheit wurden eher die menschlichen Gefahren der leeren Wissenshäufung betont, – in Anwesenheit der Jüngsten, aus deren Mund die schwer
erkämpften Grundsätze der Älteren bisweilen als allzuleichte Redensarten wiederkehrten, wurden eher die Forderungen einer vollkommenen Kenntnis zumindest des eignen Wissensgebiets
unterstrichen, als Voraussetzung jedes weitergreifenden Werks und jedes ernsthaften Urteils. Man solle nur einmal die sogenannten Maler der Gegenwart betrachten, mahnte in diesem
Zusammenhang einmal George. Nicht darum seien sie unfähige und vergängliche Schmierer, weil sie die Linien und Leiber verzerrten, – das gebe es bei Michel Angelo auch und sogar bei
Lionardo. Aber hier sei nie zu verkennen, daß die Grundlage noch des gigantischen Überbordens die vollkommene Beherrschung des schönen Maßes, ja die genaue Berechnung aller richtigen
Proportionen bilde. Dort dagegen fehlten die elementaren Fähigkeiten des Sehens und Zeichnens: „Ihr müßt Euer Handwerkszeug besser kennen und nutzen als die Bonzen, damit
sie Euch nichts am Zeug flicken können. Wenn intra muros einem von Euch ein Fehler unterläuft, werden wir ihn schon ohne viel Aufhebens richtig stellen. Aber den Neidern draußen dürft Ihr dies
Vergnügen nicht gönnen!”
Die Wissenschaft als Werkzeug vom Menschen und zum Menschen – diese Auffassung nahm der „Bildung“, die in dieser Spätzeit sich tatsächlich auf die bloße Sammlung von totem
Wissensstoff beschränkte, von vornherein den lebenswidrigen, leben-gefährdenden Charakter, der mit der Setzung der Wissensfülle als Selbstzweck und Eigenwert gegeben war. Die
positive Gestaltung der neuen Bildung vollzog sich in Leben und Lehre, dadurch daß der Mensch in seiner runden Ganzheit, als Wesen von Leib und Seele wie in der Zeit der Alten wieder in den
Mittelpunkt der Erziehung und der Bildung, des täglichen Lebens und zumal der Feierstunden rückte.
George ließ einmal aus Eckermann die Stelle vorlesen, in der Goethe von zwei Pferdeköpfen des Parthenon-Frieses sagt (20.
Oktober 1828.), „daß sie in ihren Formen so vollkommen befunden werden, wie jetzt gar keine Rassen mehr auf der Erde existieren“, und in der Goethe den Grund dieser Meisterleistung nicht darin
erblickt, „daß jene Künstler nach einer mehr vollkommenen Natur gearbeitet haben“, sondern vielmehr darin, „daß sie sich mit persönlicher Großheit an die Natur wandten.” – Persönliche
Großheit, das ist es“, sagte George. Das mußt auch Ihr Ideenfreunde Euch merken. Man muß etwas sein, um in der Erscheinung das göttliche Wesen oder, wenn Euch das leichter
scheint, die platonische Idee zu sehen.
Von hier aus und in diesem Sinn kann dann auch Goethe als „der gegenwärtigste“ gelten, und von hier aus wird „Das Hellenische
Wunder” (Blätter für die Kunst: 9. Folge.) sichtbar. Die „erkenntnis daß hier für die ganze menschheit ein unvergleichbares, einziges und vollkommenes eingeschlossen läge, dem nachzueifern alles
aufgeboten werden müsse“, – diese Erkenntnis war die Grundlage von Georges Humanismus. Aber wenn er den führenden Geistern der klassischen Zeit zuschrieb, daß sie „nicht
ein äußerliches nachzeichnen“ verlangten, „das zu dem gerügten Klassizismus führte, sondern eine durchdringung, befruchtung, eine Heilige Heirat“, so wollte uns manchmal scheinen, daß hier
weniger der Humanismus der klassischen als jener der Neuen Dichtung in klaren und verpflichtenden Worten gedeutet sei...
Als George im Jahre 1908 Lechter eine Abschrift von „Goethes letzte Nacht in Italien“ sandte, legte er ein Zettelchen bei, das
nach des Maler-Freundes Bericht, wenn wir uns recht entsinnen, so lautete: „Sie werden sagen, das ist nicht Goethisch. Aber das ist es eben“. Diese Worte könnten mit leichter Abwandlung selbst
über den wörtlichsten Übertragungen Georges stehen, – wie viel mehr noch über Sätzen des Ruhms oder des Tadels, die ja niemals wissenschaftlich etwas aussagen wollen, sondern immer in eigen
geprägter Form das Wesentliche in den eignen Raum stellen, es gestalthaft ordnen und es als Bild oder Tafel oder Norm festhalten. Daher aber dann die große und bleibende
Schwierigkeit, Georges eigenstes Wesen und eigensten Willen zu fassen. Denn was bei dem dramatischen Dichter dem Leser, Hörer und Zuschauer selbstverständlich ist: daß in den verschiedensten
Namen, Personen und Masken der eine Dichter spricht und lebt, das läßt sich beim lyrischen und epischen Dichter schwer als Tatsache begreifen und noch schwerer nach seinem offenbaren
und nach seinem verborgenen Sinn deuten.
Knüpft man an das Wort von der „Heiligen Heirat“ an, so wird zweierlei sichtbar: Der Humanismus Georges „umgreift eine Verschmelzung zweier Wesensformen und unterscheidet sich so
vom Griechentum Hölderlins, das ein geheimnisvolles geistiges Eins-Sein ist und meint; aber er unterscheidet sich durch die gleiche Verschmelzung auch vom Humanismus Goethes, der, wie
inbrünstig er auch das Land der Griechen sucht, doch meist an fremdem Strande zu harren verdammt ist.
Und doch ergreift die Ahnung, die George zu den Kindern des Inselgebiets gesellt, nicht einem ganz Bluts- und Stammes-Fremden. Der deutsche Dichter trägt in sich nicht nur
den Klang versunkener Welten, sondern auch in ihm wie in Hölderlin kreist griechisches Bluts- und Geistes-Erbe. Dies war nicht in seinem Antlitz sichtbar wie in dem des Jünglings Hölderlin,
– Georges Gesicht wies neben und vor der germanischen römisch-romanische, nicht griechische Prägung. Allein schon in frühen Sängen ertönten Weisen einer griechischen Seele und in
späten Gedichten schwillt ein Pindarischer Ton. Nah und fern zugleich, Liebender und Geliebter, – in dieser Doppelung erschließt und erfüllt sich Georges Hyperion.
Aber der Weg dieser Verschmelzung, der in dieser Form einmalig ist und nur dem Dichter eignet, führt dann doch als neue
Wirklichkeit von Hellas zu einer neuen Deutschheit, die weit über allen Bildungs-Humanismus hinaus das griechische Geheimnis in Georges neuer Jugend einzukörpern sucht. Daß der griechische
Gedanke „Der Leib sei der Gott“ weitaus der schöpferischste und unausdenkbarste, weitaus der größte, kühnste und menschenwürdigste sei, dem an Erhabenheit jeder andre, sogar
der christliche, nachstehen müsse (Blätter für die Kunst. 9. Folge.), das war nicht nur Georges Glaube, nicht nur sein schicksalhaftes Erlebnis, sondern Grundlage und Richtbild seiner Erziehung.
Darum konnte er sagen: „Was man so Humanismus nennt, interessiert mich nicht. Ich erwarte mehr von Euch. Ihr müßt so sein, daß Ihr Euch stark genug fühlt, um es mit den Griechen aufzunehmen.“
Diese Erziehung, die nicht nur den Geist, die auch den Leib zu ergreifen und zu prägen wußte, lenkte mit Notwendigkeit das
Auge stärker auf die griechischen Bildwerke als auf Sprache und Dichtung der Alten. Für den Neuling, der von der Schule eine gute Kenntnis der alten Sprachen und auch ein wenig gymnasialen
Bildungsdünkel mitbrachte, wirkte es zunächst überraschend und enttäuschend, wie wenig darum sein vollbepackter Schulsack galt. Mit Erstaunen erfuhr er dann, daß Gundolf den Platon fast nur in
Übersetzung las, und sein Erstaunen wuchs, als er vernahm, daß manche der älteren und viele der jüngeren Freunde Griechisch nicht konnten und nicht lernten. George, der selbst die „toten“
wie die lebenden Sprachen beherrschte, gab auf eine frühe Frage nur die kurze Antwort: „Es gibt heute viele Wege zum griechischen Wunder.“
Im Verlauf der Jahre wurden manche Wege gezeigt oder gemeinsam begangen. Gezeigt ist freilich eine vergröbernde Benennung von Seiten des Belehrten, – Georges Zeigen bestand
oft nur in einem behutsamen Fragen, und es war der Einsicht und Kraft des Gefragten überlassen, ob und wie weit er Lücken, welche der meisterliche Hinweis offenbarte, zu schließen fähig und
willens war. Den wichtigsten deutschen Weg nach Hellas eröffnete, – vielleicht besonders für die Heidelberger Freunde, deren tägliches Leben in diesem Zeichen stand, – mit seinen
großen Hymnen und mit den Übertragungen aus Sophokles und Pindar Hölderlin. Aber neben ihm wurde früh ein zweiter Name genannt, – Gundolf und Hellingrath vertraut, uns Andern ein
belehrender Hinweis –, Winckelmann.
Neben diese edelsten, George wohl nächsten Führer zur Antike traten im Gespräch Goethe und Nietzsche. Über Goethes Pindar-Erlebnis wurde gesprochen, Nietzsches Geburt der
Tragödie aus ihrer zeitlichen Verhaftung gelöst und sein Dionysos mit Hölderlins Bacchus verglichen. Zum ersten Mal trat uns Jüngeren der Name Bachofen entgegen, – das Mutterrecht
erschloß einen neuen Raum der Antike und verknüpfte zugleich die Heidelberger Jahre mit der schon sagenumwobenen Zeit der Münchner Kosmik. Weitere Belehrung bot Fustel de Coulanges,
Otfried Müller und später Burckhardt, und die Einbildungskraft erhielt fruchtbare Anregung durch ein sonst verschollenes, doch George liebes Buch: „Historische Landschaften“ von Julius Braun.
Aber wichtiger als all dieser Lesestoff, wichtiger auch als das Lesen der Werke der griechischen Dichter und Weisen, um deren neue Übertragung sich viele der jungen Freunde mühten, war
solche Vertiefung in das Anschauen der griechischen Bildwerke, daß aus dem schönen Wesen und Leben der Menschen und Götter, wie es Bronze und Marmor über die Jahrtausende hinweg
bewahrten, ein verklärender Schein auf die um den Meister gescharte Jugend fiel und ein anspornender Ruf ihr Sinnen und Tun begleitete.
Georges Dichtung und Hölderlin und das Griechentum – diese Drei-Einheit schwebte so Georges Jugend bestimmend vor, und aus ihrem neuen Leben erwuchsen neue Sichten zu neuem Werk.
Georges Hyperion-Gedichte sind allen Jüngeren, die diese Zeit und diese Feier-Stunden miterlebten, als schönste Verewigung dieser „Heiligen Heirat“ erschienen, und gewiß wird bis in ferne Zukunft
aus ihnen Georges Griechentum und Griechenbild am reinsten leuchten. Aber jede Gestaltung schafft währendes Leben in Prüfung, Auswahl und Formung des Lebensstoffes, – jedes Bild
wird Wirklichkeit, indes es eine Flächen- und Tages-Wirklichkeit aufhebt...
Es mag in fernen Jahrhunderten ein Tag der Erfüllung kommen, da man in den Hyperion-Gedichten nur die schöne Verheißung
hört. Uns, die wir geglaubt hatten, in liebender Nähe zum Meister an seinem Leben etwas teil zu haben, erschütterte umgekehrt beim ersten Lesen die Todesmüdigkeit des Sehers, die in aller
Verheißung mitschwingt und die wir noch nie wahrgenommen hatten. „Mein leidend leben neigt dem schlummer zu“, – als wir diesen Vers zu Beginn des ersten Weltkriegs vernahmen, griff uns
die bange Angst ans Herz, daß ein Unheilsschatten auch über dem Meister lagere und über seiner und unsrer Welt, – ein Erschrecken von einer Tiefe und Nachhaltigkeit, daß eine ganze unbeschwerte
Jugendzeit darin versank. Denn es braucht wohl immer einen besonderen Anlaß oder Wink, damit die Jünger inne werden: so sehr auch der Meister Menschen-Maß übersteige, – kein
Menschen-Schicksal bleibt ihm erspart.
Gerade die Versenkung in die Schönheit der Antike aber war es, von der für die Jugend um George nicht nur hoffender Überschwang, sondern selbstsicher Siegesgewißheit den Ausgang
genommen hatte. Vom Venusthron, dessen Bilder ihre Zimmer schmückten, – von der Athene des Myron, deren Nachbildung in attischem Marmor damals neugefunden und in Frankfurt
aufgestellt war und zu der sie – wie oft! – gemeinsam pilgerten, – von Anmut und Würde der hohen Hellenen ging ein Zauber aus, daß ihnen das Freundesleben, von berauschender Schönheit
erfüllt, als Gewähr und Beginn einer neuen, deutschen Wiedergeburt von Hellas, eines hellenischen Deutschtums erschien. Als nach dem ersten Weltkrieg die Überlebenden,
gereifter durch die überwundenen Jahre, doch auch in ihren Hoffnungen gedämpfter, sich wieder in Heidelberg zusammenfanden, war darum ihr stärkster Trost und gab ihnen
neuen Mut, daß Georges Nachkriegsjugend mit gleicher Kraft die alte Fahne der Drei-Einheit hißte. Woldemar Uxkulls jugendlich-kühnes Vorwort zu „Frühgriechische Plastik“ band
wieder Hellas-Hölderlin-George zu fruchtbar schönem Lebensbund, und abermals schien zukunftsträchtig der Freundschaftsreigen, zu dem Eros führte.
Georges Blick jedoch reichte nicht nur in andere Weiten als die schärfsten Augen der liebenden Jünger, sondern seine Weisheit wahrte auch in Bewunderung und Verehrung das geziemende
Maß, das ihre Hoffnungen leicht übersprangen. Sein Griechentum war zu sehr heutig und deutsch, um wie die Vordern an eine einfache Renaissance zu glauben und zu sehr seiner
Zukunft-Sende gewiß, um sich damit zu begnügen. Alle Renaissance meinte und war eine Wiedererweckun der Antike in christlicher Zeit, oft im christlichen Geist. George aber war davon
durchdrungen, daß diese christliche Zeit ihrem Ende entgegen ging, und sein Griechentum war daher als erstes a-christlich oder nach-christlich von Natur und Geist.
Freunde haben, zumal aus Georges letzten Lehensjahren, von anti-christlichen – richtiger wohl: von anti-kirchlichen Äußerungen
das Dichters berichtet, – in der Heidelberger Zeit haben wir Jüngeren nur anti-protestantische vernommen. Aber auch ihre Zahl und ihr Gewicht war nicht so groß, daß daraus allein Georges
Stellung zum Christentum hätte erschlossen werden können, – sie fielen zudem stets in anderem Sinn-Zusammenhang, sei es daß George die lebenswidrigen, brüchigen Gegenstellungen der
modernen Welt beleuchten, sei es daß er den Weg zum antiken Eros von moderner Verunreinigung säubern wollte. Wie denn George von Natur zu sehr baumeisterlich veranlagt war, als daß er
selbst im Gespräch sich längere Zeit bei einem bloßen „Gegen...“ aufgehalten hätte – alle „Anti“-ismen waren ihm genau so verhaßt wie die oft verspotteten -ismen. Nur in Georges aufbauendem
Sinn, allein zur Deutung seines Griechentums, sei denn auch hier von seinem Christentum gesprochen.
Daß mit George zum erstenmal wieder seit dem Mittelalter der deutsche Katholizismus „lebendiges Wort und neue Gestalt“ geworden ist, hat Friedrich Gundolf festgestellt, und in dem
antithetischen Sinn, wie er es meinte: daß nach dem Ende der mittleren Zeit das herrschende Leben des deutschen Geistes von der Reformation oder von der Renaissance oder von beiden
zusammen ausging, doch nicht vom Katholizismus, – in diesem Sinn dürfte wenig gegen Gundolfs Aussage einzuwenden sein. Ebenso ist unbestreitbar katholisch an George das Maß der Höhen
und der Tiefen, der Sinn für Stufenfolge und Rangordnung, die Vereinigung von östlicher Ekstase und gotischem Flug und römischer Wucht. Und dennoch haben die Wortführer der Kirche,
die gegen George in die Schranken traten, richtigere Witterung besessen als die Wortführer des Liberalismus, die ihn und die Seinen katholisierender Tendenzen „beschuldigten“. Denn George
war nicht deutscher Katholik, sondern – wenns dies Wort verstanden wird – der erste katholische Nicht-Christ.
Man hat verschiedentlich von einem „Neuheidentum“ Georges gesprochen. Auch dies Wort trifft den Tatbestand nicht. Denn Georgie ist tatsächlich in gleichem Maß katholisch wie römisch
gewesen, doch jenes nicht dem Glauben, dieses nicht dem Blut nach, sondern beides als Berger und Hüter von zwei Weltkräften, die als Römertum und als Katholizismus ihre größte geschichtliche
Erscheinungsform gefunden haben, und beides – wie die heimischen Gaue und das Elternpaar – aufbauende Elemente seines nur ihm so eigenen, deutschen Wesens. Wer Georges „Der
kindliche Kalender“ richtig liest, wird gewahr werden, wie sehr schon der Knabe George den Katholizismus nicht „nordisch” als Glaubensbekenntnis, sondern nach Art der südlichen und der
rheinischen Menschen als Entsprechung und Begehung der Gezeiten von Mensch und Natur durchlebte, und wird schon dort das Grauen und die Verwunderung ab des Wote-Liedes der
Schnitter nicht überhören: „daß ein seit jahrtausenden entthronter Gott noch in erinnerung sein sollte während ein heutiger schon in vergessenheit geriet”. Da christlich an Christus
glauben alle andern Götter ausschließt und da Christ-Sein nicht vom Glauben an die Erbsünde zu trennen ist, darum ist George kein Christ gewesen. Aber da das Katholische alle menschlichen,
alle natürlichen und alle göttlichen Substanzen barg, die George in der Antike sah und ehrte und als verwandt ergriff, darum hat er nie – wie der ewige Protestant Nietzsche – am Christentum
gelitten, sondern hat das Katholische als Erbgut und als Bestandteil seiner neuen Sende eingeschmolzen. Dieser vielgestaltigen lebendigen Einheit wird keine begriffliche
Scheidung gerecht. Aber wenn in den „Blättern“ (9. Folge.) Goethe die Worte in den Mund gelegt werden: „Griechheit, so hoffe ich, wird es immer geben, wie es auch einen Katholizismus schon gab
vor der Kirche“, so hätte George sagen können: „Griechheit gibt es heute wieder, und ebenso einen Katholizismus nach der Kirche“.
Er hätte es sagen können – gesagt hat er es nicht. Denn wie schon in Georges Stellung zu Goethe die behutsame Ehrfurcht als
bestimmender Wesenszug hervortrat, die nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame hervorhebt, so auch in seiner Stellung zum Christentum. Und wie dort das Bewußtsein der neuen
Weltzeit vielleicht am deutlichsten durch die kaum beachtete Zusammenfassung und Scheidung „Das Jahrhundert Goethes” sichtbar wird, so hier durch die Feier Christi als „herrscher des
längsten weltreiches unsrer überlieferung“.
Allein indem Christus nicht gestürzt wird, sondern in neuer Glorie einzieht in den Olymp der alten und der neuen Götter, verliert
nicht nur die christliche Kirche für George ihre Macht, sondern wird das Katholische seinem antiken Ursprung neu verbunden. Und darum liegt im Müde-Werden des Christentums für George weder
ein Grund zu Kampf und Verwerfung, noch gar ein Anlaß zu Jubel und Triumph, sondern umgekehrt ein Zeichen des Alterns der Welt, ein dräuendes Menetekel und ein gebieterischer Ruf: selbst
die noch heilen Kräfte zu sammeln und für die kleine Zahl der Getreuen das Banner aufzupflanzen, um das geschart sie dem Ansturm des Widerchrist zu begegnen vermöchten. Den
Widerchrist sah George nahen und die Masse „entzückt von dem teuflischen schein“ sah er rettungslos seinen lügnerischen Blendreden verfallen. Aber da Christus ihm nicht mehr hinreichend
Macht verkörperte, um der satanischen Widerwelt Herr zu werden, darum fühlt er sich zwar in Verehrung hingezogen zum großen Papste seiner Zeit, der, „ein Vorbild erhabenen prunks und
göttlicher verwaltung“, in einer Welt voll Frevel und Vernichtung die stille Würde seines Amtes wahrte, Leo XIII., – doch der Seher weiß:
Das neue heil kommt nur aus neuer liebe.
Der ehrfürchtige Aufblick zu dem greisen Kirchenfürsten bestätigt so nur das tiefste, das antikische Wissen Georges, und Jesus
selbst wird, wie ihn antike Apokryphen sahen, wieder zum Herrn des Reigens, zu Eros’ Bruder, – Christ im Tanz...
Wenn aber so Georges Katholizismus antikisch zu verstehen ist, dann sein antikes und sein katholisches Wesen deutsch, –
deutsch freilich, wie früher sichtbar wurde, nicht in einem engen, nationalen oder gar nationalistischen Sinn, sondern in seiner größten, europäischen, ja kosmischen Weite. Und Platon ist wohl
nicht nur als Künder des Eros, sondern als Binder der verschiedensten geistigen Weltstoffe in ähnlicher Zeitenwende George von allen Großen der Antike der nächste gewesen und ihm
brüderlich verwandt erschienen, weil von ihm am Beginn jener Epoche, die George abschließt, sich ähnlich sagen ließe: daß er antikes und katholisches Wesen vereint ...
Als einmal der Verfasser des Platon-Buches die Frage stellte, ab George ihm zustimme, daß Platons Worte auf dem Totenbett nicht
späte Erfindung, sondern echte Überlieferung seien, erwiderte der Meister (6. Juli 1920.): „Warum sollen wir bezweifeln, daß Platon sich glücklich pries, als Mensch, als Grieche und Zeitgenosse des
Sokrates geboren zu sein? Die Worte sind Platon angemessen. Ob er selbst sie noch sprach oder ein Dichter wußte, was er sagen wollte, ist nur ein interessanter Brocken für Philologen“. Auf die
weitere Frage, ob nicht „als Athener“ echter klänge denn als „Grieche” war die Antwort: „Grade nein“. Gewiß sei es ebenso töricht, vom antiken Griechenland als politischer Einheit zu
sprechen als wenn man das Italien der Renaissance als Einheit fasse. – „Erst die moderne Geschichtswissenschaft mit ihrer verlogenen Voraussetzungslosigkeit hat mit ihren Deutelkünsten
die Geschichte nationalistisch verfälscht“, – aber wie der Florentiner Dante Italiener, so sei der Athener Platon nach Haltung und Willen Grieche gewesen. Und dann kam der
überraschende Schluß: „Oder irren wir uns? Waren sie vielleicht – Deutsche?“
Es war das Besondere an solchen Worten Georges, daß sie nicht nur das Gespräch auf eine andere Ebene rückten, daß sie von
toter Historie zu lebendigem Symbol hinführten, sondern daß sie die Luft des Raums, ja die Menschen veränderten. Wie vorher sprach der Meister mit seinen Jüngern, doch Gesten geschahen
und Worte fielen wie unter einem Zauberbann. Keiner wäre verwundert gewesen, wenn die Tür sich geöffnet hätte und Dante und Platon herein getreten wären. Ja – waren sie nicht
gegenwärtig? Strahlten nicht um des Meisters Antlitz auch die Züge der Ahnen?
Als keine Antwort kam, fuhr George fort: „Ihr dürft die Großen nicht in Schubfächer pressen wollen. Das hohe Leben spottet Eurer armen Begriffe. Sie erfuhren jetzt, was das heißt:
Allgegenwart“.
Dem Sehenden war
Der Wink genug · und Winke sind
Von Alters her die Sprache der Götter.
Mit diesen Versen Hölderlins, die George seiner Hyperion-Trilogie voranstellt, ist der mythische Bogen von George zu Homer geschlossen. Aber wieder, – so sei zum andern Mal Georges
ahnende Gesellung zu Hellas gedeutet –, wieder geschieht es nicht aus geschichtlichem Wissen, sondern aus verwandter Seele und verwandten Glauben.
Als Hellingrath Hölderlins Rousseau-Gedicht las, war es der Berichter, der zu dieser Stelle darauf hinwies, daß wohl eine Erinnerung an Homer hier ihren Abdruck finde. George wandte
schnell den Kopf zu dem Sprechenden, warf ihm – wie es oft seine Art war – einen durchdringend scharfenn Blick zu, sah wieder fort und schwieg. Es war kein Blick der Billigung, keiner des Tadels.
Der vorlaute Jünger, der nun selbst betreten schwieg, hat ihn wohl richtig so gedeutet, daß George sich vergewissern wollte, ob der Sprecher eine belanglose philologische Erläuterung zu geben
dachte oder ob ihm ein tieferer, dichterischer Zusammenhang deutlich sei. Hätte dieser antworten müssen, wäre ihm das Geständnis nicht erspart geblieben, daß erst des Meisters Blick
ihm blitzartig die Tiefen aufriß und erhellte ..
Allein aus diesen Tiefen aber ist Georges – wie Hölderlins – inneres Verhältnis zur Antike zu erschließen und zu verstehen.
Kraft seiner antiken Substanz sah George wie die Kinder des Inselgebiets das Weltall von Göttern erfüllt und den hohen Menschen als der Welt und der Götter vollkommenste und
schönste Erscheinung, sah er das Leben durch die Götterlosigkeit bedroht und wach nur durch den Zauber, sah er in Begehung und Bild die zeugende und erhaltende Macht allen Daseins und die
schöpferische und bindende Stärke aller Gemeinschaft. Aber nicht als geschichtskundiger Wisser, sondern als Träger und Dulder der gleichen Urkraft, als Deutscher dieser neuen Zeitenbiege, beim
Nahen einer andren Neige der Welt, beschwor er die in ihm lebensträchtigen Ahnen, auf daß ihr hehrer Name und ihre alt-neue Wirklichkeit als Vorbild und Mahnung, als Stütze und
Verheißung den Tag erhelle, die Untergänge siegreich überdaure und strahlend aus Traum und Dunkel in die Zukunft führe. „Dem Sehnenden war der Wink genug“ ...
 |
  |