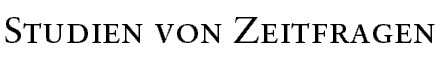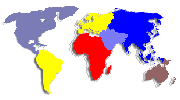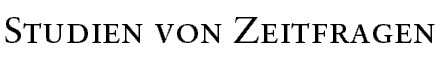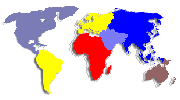|
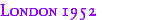
Das Londoner Schuldenabkommen
von Hermann Josef Abs
in: Zeitfragen der Geld- und Wirtschaftspolitik, Frankfurt 1959 (*)
Über das Schuldenabkommen ist so viel Oberflächliches und Unfachmännisches geschrieben und gesagt worden, daß es, glaube ich,
notwendig ist, sich einmal im Ernst über einige Punkte, den Inhalt, die Form sowie die Bedeutung des Schuldenabkommens für die Gesamtwirtschaft auszusprechen.
Kritik ist, wenn sie sachlich sein, also der Sache dienen will, sehr
begrüßenswert. Als Sprecher der Deutschen Delegation fühle ich mich verpflichtet, Ihnen das Abkommen in großen Zügen so darzustellen, daß auf
dieser Basis eine konstruktive Kritik aufgebaut werden kann. Im ganzen hoffe ich jedoch, auch Sie werden an die Beurteilung des Abkommens mit
der Uberzeugung herangehen, daß die Regelung der seit vielen Jahren nicht mehr bedienten deutschen Auslandsschulden zur Wiederherstellung des
deutschen Kredits unerläßlich war. Ich war mir dabei von vornherein der Undankbarkeit unserer Aufgabe in London bewußt. Als der Herr Bundesfinanzminister Schäffer mit mir den Auftrag zur Leitung der
Deutschen Delegation besprach, sagte er: »Herr Abs, wenn Sie es schlecht machen, werden Sie an einem Birnbaum aufgehängt und wenn Sie es gut
machen, an einem Apfelbaum.« Trotzdem habe ich den Mut zu glauben, daß eines Tages die Schuldenregelung, und das wäre das beste Kompliment
für dieses Abkommen, als eine Selbstverständlichkeit angesehen wird. Ich denke dabei an die Neuordnung der Großbanken, die sogenannte
Dreierlösung, die, als sie vor 2 1/2 Jahren erfunden und betrieben wurde, meist auf Ablehnung stieß. Heute dagegen wird sie schon fast als überholt,
mindestens aber als eine Selbstverständlichkeit angesehen.
Das Schuldenabkommen ist zunächst nur getroffen zwischen Vertretern
der Gläubiger und Vertretern der Schuldner. Es waren vier Etappen der Verhandlungen, die bekanntlich im Mai 1951 begonnen haben und noch
nicht abgeschlossen sind. Die letzte Etappe steht kurz bevor: die Vorlage des in den Monaten November/Dezember 1952 zwischen den drei Mächten
Amerika, England und Frankreich einerseits und der Bundesrepublik andererseits ausgehandelten zwischenstaatlichen Abkommens vor den zum
Beitritt aufgeforderten übrigen Gläubigerstaaten. Es handelt sich insgesamt um 65 Staaten. Es scheint mir notwendig zu sein, daß man dem Abkommen
mehr Verständnis entgegenbringt, als man im allgemeinen antrifft, denn wenn nicht die Wirtschaft, sprich: diejenigen Kreise, die die Schuldner
repräsentieren, das Abkommen für gut hält, dann können wir kaum von den Politikern erwarten, daß sie ihr »Ja« dazu geben.
Im Mai 1952 machte die Deutsche Delegation nach Vorberatung im
Kabinett an die Adresse der Gläubiger ein Angebot, und zwar: eine jährliche Summe von 500 Millionen DM zu transferieren, die nach 3 – 4 Jahren um
100 Millionen DM erhöht werden sollte. Dieses Angebot, am 23. 5. 1952 abgegeben und begründet, wurde von den Gläubigern am 30. 5. als unbefriedigend abgelehnt. In der vorangegangenen Woche hatte man
durch Absprache sorgfältig geklärt, was zu tun sei, wenn die Gläubiger dieses Angebot ablehnen. Sollte der nächste Schritt sein, daß die Deutsche
Delegation nach Hause fährt, um ein höheres Angebot zu holen, oder die Gläubiger zu bitten, ihrerseits Vorschläge zu machen? Wir sind übereingekommen, in Einzelunterhaltungen zu versuchen, eine Lösung zu
finden, wie immer die Anforderung der Gläubiger aussehen würde; eine Lösung, die für die Gläubiger noch annehmbar und für die Schuldner noch tragbar ist.
Bei der Ablehnung des deutschen Angebots haben die Gläubiger 4 Thesen aufgestellt:
Die 1. These lautete:
Der Schuldner kann nicht nach dem gemessen werden, was Deutschland
zu transferieren in der Lage ist, sondern nur danach, ob der Schuldner für seine Verpflichtungen in D-Mark »gut« ist oder nicht.
Was heißt »gut«? Ich spreche nicht von einem guten Schuldner im Sinne
der Moral, sondern in dem Sinne, daß ein Schuldner für seine Verpflichtungen gut ist, d. h. daß von ihm die volle Erfüllung seiner Verpflichtungen erwartet werden kann. Sie sehen daraus, daß ein guter
Schuldner in diesem Sinne nicht ohne weiteres, mit einem, guten Schuldner im moralischen Sinne identisch zu sein braucht.
Was bezwecken die Gläubiger damit? Sie wollten, daß der Schuldner
mindestens in D-Mark voll erfüllt, und wenn nur ein Teil davon transferiert werden kann, so sei das eine Angelegenheit, die im Rahmen der
Transferfrage behandelt werden müsse. Die Differenz also, so erwartete man, sollte, solange die Devisenbewirtschaftung besteht, in D-Mark auf Sperrkonto gezahlt werden.
Die 2. These lautete:
Das Angebot von 500 Millionen D-Mark ist unbefriedigend und muß wesentlich erhöht werden.
Die 3. These lautete:
Die Deutsche Delegation kann sich nicht damit begnügen, einen global zu
zahlenden Betrag zu nennen; das Angebot muß sich vielmehr mit jeder einzelnen Schuldenkategorie befassen.
Die 4. These lautete:
Das Angebot Deutschlands muß ein unbedingtes sein; es darf also nicht
von handelspolitischen, wirtschaftspolitischen, währungspolitischen oder allgemeinen politischen Voraussetzungen abhängig gemacht werden.
Ich möchte mich zunächst damit befassen, wie diese vier Thesen im Abkommen selbst, das am 8. 8. 1952 abgeschlossen wurde,
Berücksichtigung fanden, inwieweit also die Gläubiger ihren Standpunkt durchsetzen konnten.
Die 1. These – der Schuldner soll voll in D-Mark zahlen.
In London wurde erreicht, daß der Maßstab für die Leistungen der
Schuldner sich auf die Transferfähigkeit der Bundesrepublik beschränkt. In keinem Fall und bei keiner Schuldenkategorie werden also neben den zu
transferierenden Beträgen noch ergänzende Leistungen in DM auf Sperrkonto zu erfüllen sein, d. h, die Ermäßigungen, die für Deutschland von
der Transferseite her durchgesetzt werden konnten, kommen zur gleichen Zeit auch dem Schuldner, gleichgültig ab öffentlicher oder privater
Schuldner, endgültig zugute. Dieses Ergebnis zu erzielen war zumindest bei den privaten Schuldnergesellschaften nicht leicht, die auf den ersten Blick in
ihre Bilanzen und ihre Kapitalumstellung als genügend leistungsfähig anzusehen waren, um ihre alten Verbindlichkeiten im Laufe der Zeit voll
abzudecken. Welche Bedeutung dieses Ergebnis hat, erhellt daraus, daß zusätzliche Leistungen in D-Mark auf Sperrkonto von Volkswirtschaft zu
Volkswirtschaft noch zu erfüllen gewesen wären, denn mit der Gutschrift von D-Mark auf Sperrkonto ist ja die Verpflichtung von Deutschland an das
Ausland noch nicht abgewickelt. Welche Bedeutung das hat, wird jedem von Ihnen deutlich sein, der aus der Presse erkennt, mit welcher Kühnheit
der Gedanke erörtert wird, die Devisenbewirtschaftung in Gänze zügig und großzügig durch Aufsprengung der Transferfesseln abzuschaffen. In demselben Augenblick wären dann die in D-Mark auf Sperrkonto zu
leistenden Beträge zugleich zusätzliche Transferverpflichtungen der deutschen Volkswirtschaft geworden.
Die 2. These – der Betrag von 500 Millionen DM muß wesentlich erhöht werden.
Das ist geschehen. Die 500 Millionen DM sahen die Bedienung des
Schuldendienstes für die Nachkriegs- und die Vorkriegsschulden vor. Die Nachkriegsschulden sind im dritten Abschnitt der Konferenz, im Dezember
1951, auf Grund eines Angebotes der drei GIäubiger Amerika, England und Frankreich vorläufig geregelt worden, indem diese Staaten ihre Forderungen beträchtlich ermäßigt haben. Der wesentliche Inhalt der
Nachkriegsforderungen sind die Leistungen Amerikas, bekannt unter den Titeln GARIOA und Marshallplan; sie betrugen allein etwa 3,2 Milliarden Dollar
und wurden durch einen Nachlaß von 2 Milliarden auf 1,2 Milliarden Dollar ermäßigt. Die entsprechende Forderung des Vereinigten Königreiches
betrug nur 200 Millionen Pfund, die auf 150 Millionen Pfund ermäßigt wurde. Die französische Forderung von rund 16 Millionen Dollar, die ebenfalls um
25% gekürzt wurde, spielt in diesem Zusammenhang dem Betrage nach keine bedeutsame Rolle.
Von den 500 Millionen DM hätte der Schuldendienst für die Nachkriegsverpflichtungen einschließlich der Schweizer Clearing-Schulden
und einer Verpflichtung an Dänemark aus Aufwendungen für deutsche Flüchtlinge allein schon 330 Millionen DM ausgemacht, so daß für die Bedienung der Vorkriegsschulden nur 170 Millionen DM übriggeblieben
wären, die nach Jahr und Tag – nach drei Jahren – um 100 Millionen auf 270 Millionen DM hätten erhöht werden sollen.
Ich möchte an dieser Stelle schon sagen, was das Ergebnis der Londoner Schuldenkonferenz gewesen ist:
Die im Jahr laufend zu transferierende Summe beträgt nicht 500 Millionen
DM, wie ursprünglich angeboten, sondern etwa 563 Millionen DM, wobei etwa 370 Millionen DM auf die Öffentliche Hand für Vor- und Nachkriegsschulden und der Rest von rund 200 Millionen auf die privaten
Vorkriegsverbindlichkeiten entfallen. Der Betrag von 563 Millionen DM wird sich nach fünf Jahren auf etwa 765 Millionen DM erhöhen, d. h. die
endgültige Summe ab 1958 wird um 165 Millionen DM gegenüber den ursprünglich vorgesehenen 600 Millionen DM überschritten. Ich muß hierbei darauf aufmerksam machen, daß diese Ziffern keinen Anspruch auf
Genauigkeit erheben, daß sie auf einseitigen Angaben der Schuldner beruhen und zu einem wesentlichen Teil Auslandsanleihen betreffen. Nun
dürfen wir uns von dieser Verpflichtung ab 1958 nicht so sehr erschrecken lassen, ganz abgesehen davon, daß weder wir noch internationale Experten
übersehen können, wie groß unsere Leistungsfähigkeit zu diesem Zeitpunkt sein wird. Wir müssen vielmehr unser Augenmerk auf die Verpflichtungen für
die ersten fünf Jahre richten, die von 500 um nur 67 Milionen DM erhöht worden sind.
Es ist zu berücksichtigen, daß mit dieser Regelung nicht alle Auslandsschulden Deutschlands geordnet sind. Darüber möchte ich jedoch
noch gesondert sprechen. Hier interessiert, daß in der Londoner Konferenz eine These aufgestellt wurde, die es uns erleichtert hat, für die ersten fünf
Jahre nur eine minimale Erhöhung unseres ersten Angebots zuzugestehen. Sie bestand darin, daß in den ersten fünf Jahren ein Gläubiger entweder nur
Zinsen oder nur Amortisationen, aber nicht beides zu gleicher Zeit auf die gleiche Forderung erhält. Das brachte die Amerikaner wegen der von ihnen
konzipierten Regelung der Nachkriegsforderung in eine gewisse Schwierigkeit. Sie hatten ursprünglich feste Annuitäten von fast einer viertel
Milliarde DM vorgesehen, die im Laufe von 35 Jahren auf ihre Ansprüche aus der GARIOA- und Marshallplan-Hilfe abzutragen waren. Sie haben sich in
Anlehnung an die eben erwähnte These bereit gefunden, die Zahlung des Tilgungsanteils um fünf Jahre aufzuschieben, so daß in den ersten fünf
Jahren nur die Zinsen in Höhe von 2 1/2% zu zahlen sind. Durch diese Aufschiebung, die fast 92 Millionen DM ausmacht, war es möglich, für die
ersten fünf Jahre mit der Erhöhung des Jahressolls um 67 Millionen auszukommen; anderenfalls hätte die Erhöhung 160 Millionen DM betragen.
Selbstverständlich wirken sich die aufgeschobenen Tilgungen in der – erheblicheren – Erhöhung ab 1958 aus. Nun wird Sie interessieren, daß sich
der deutsche Exportüberschuß in den ersten acht Monaten 1952 genau auf 563 Millionen DM belaufen hat, allerdings nicht in den Währungen, in denen
wir unsere Schulden in den nächsten Jahren zu bezahlen haben werden. Ich brauche hierbei nur an das leidige Kapitel Brasilien zu erinnern. Allein unser
Exportüberschuß gegenüber Brasilien oder, besser gesagt, unser Saldo in Brasilien würde etwa ausreichen, einen Jahresschuldendienst zu decken, wenn er in einer konvertiblen Währung ausstünde.
Ehe ich auf die wirtschafts- und währungspolitische Bedeutung der 567
Millionen und der 365 Millionen DM ab 1958 zurückkomme, möchte ich zunächst die Thesen 3 und 4 weiter behandeln.
Die 3. These – Deutschland darf keinen Globalbetrag nennen, sondern muß sich mit jeder einzelnen Schuldenkategorie befassen.
Das hat die Deutsche Delegation getan. Diejenigen von Ihnen, die das
Schuldenabkommen schon gelesen haben, konnten erkennen, daß wir uns mit jeder einzelnen Schuldenkategorie befaßt, die wichtigsten Anleihen und
ihre Bedienung festgelegt und abgesprochen und, soweit es private Schuldengruppen sind, für sie Richtlinien festgelegt haben, nach denen diese Schuldengruppen zu behandeln sind.
Die 4. These – das Angebot muß ein unbedingtes sein; es darf nicht von
handelspolitischen, wirtschafts- und währungspolitischen oder allgemeinen politischen Voraussetzungen abhängig gemacht werden.
Dies ist eine außerordentlich wichtige These, die wie folgt behandelt
worden ist. Die handels- und währungspolitischen Voraussetzungen sind eingehend im Schlußbericht der Konferenz niedergelegt, einmal unter den
Gesichtspunkten, die vor der Regelung der Schulden vorgeherrscht haben – das ist in Abschnitt 11 des Schlußberichtes geschehen – und dann unter
Anführung bestimmter Prinzipien und Grundsätze, die hauptsächlich in den Abschnitten 21 und 22 des Schlußberichtes behandelt sind. Es ist in diesen
Abschnitten gesagt, daß die Deckung für die Transferverpflichtungen Deutschlands nur aus einem laufenden Uberschuß der Handels- und
Dienstleistungsbilanz, also der sichtbaren und unsichtbaren Transaktionen gefunden werden kann, um zu vermeiden, daß mehr als eine nur vorübergehende Inanspruchnahme der Währungsreserven eintritt. Ferner
wurde gesagt, daß auf die noch nicht erreichte Konvertibilität der Währungen Rücksicht zu nehmen ist. Was das bedeutet, brauche ich nach
den Erfahrungen mit Brasilien nicht im einzelnen darzulegen. Weiter heißt es, daß nicht durch Einschränkung des Handels, der Produktion, des
Verbrauchs und nicht durch eine Austerity-Politik das Problem unserer Transferverpflichtungen gelöst werden kann, sondern nur durch Ausdehnung und Ausbreitung des Handels im Sinne der Liberalisierung.
Diese Prinzipien sind einstimmig von den Gläubigern und Schuldnern und allen beteiligten Vertretern von 31 Ländern am 8. 8. 1952 zum Beschluß
erhoben worden. Sie haben, wie Sie nachher erkennen werden, ihre besondere Bedeutung für unseren Schuldendienst gegenüber dem Dollarraum, der während der Verhandlungen stets unsere Aufmerksamkeit in
Anspruch nahm. Es wurde ferner gesagt – und dies ist inzwischen durch Vereinbarungen mit der Dreimächtekommission geschehen – daß in dem vorgesehenen zwischenstaatlichen Abkommen Bestimmungen enthalten
sein müssen, die sicherstellen, daß es zur Befriedigung aller Beteiligten, der Schuldner und Gläubiger, funktioniert; und schließlich, daß im Abkommen für
den Fall Vorsorge getroffen werden soll, daß Deutschland sich trotz der größten Anstrengungen und wider alles Erwarten bei der Erfüllung des
Transfers Schwierigkeiten gegenüber sieht, die es allein nicht lösen kann. Die hierin mitgeteilten Bestimmungen sind also handels- und
wirtschaftspolitische Voraussetzungen, die uns in der 4. These der Gläubiger nicht zugestanden wurden, die aber letzten Endes in der Konferenz und
dem Schlußbericht verankert wurden und inzwischen in den Entwurf zu dem erwähnten zwischenstaatlichen Abkommen übernommen worden sind.
Unter den handelspolitischen Bestimmungen ist besonders noch die
folgende von Bedeutung: die Leistungen des Schuldendienstes sollen als laufende Transaktionen in den Zahlungs- und Handelsabkommen Aufnahme
finden, die Deutschland mit den verschiedenen Ländern getroffen oder noch zu treffen hat. Das bedeutet also: wenn ein Zahlungs- und Handelsabkommen zwischen Deutschland und einem bestimmten Land zu
schließen ist, so muß bei der Festsetzung der Quoten, d. h. der Einfuhr- und Ausfuhrmengen, auch der Betrag berücksichtigt werden, der dem
Schuldendienst entspricht; mit anderen Worten: wenn ein Land uns Heringe verkaufen will und zugleich auch Gläubiger ist und von uns Walzwerkserzeugnisse erwartet, so muß bei den deutschen Lieferungen als
Gegenposten auch auf die zu leistenden Schuldbeträge Rücksicht genommen werden.
Nur in einem Punkt ist es nicht gelungen, eine Ubereinstimmung mit den
Gläubigern zu erreichen und eine Verankerung im Schlußbericht über die Konferenz durchzusetzen – das ist die Frage der politischen Voraussetzungen, unter denen wir das Schuldenabkommen erfüllen können,
nämlich das Problem der Reparationen. Es ist auch im Deutschland-Vertrag, wie Sie wissen, noch nicht gelöst. In diesem Vertrag ist lediglich gesagt, daß
die endgültige Regelung der Reparationsfrage erst im Friedensvertrag oder in früheren Abkommen erfolgen kann. Die Deutsche Delegation hat aber in
der wichtigen Schluß-Sitzung mit aller Deutlichkeit und allem Ernst erklärt, daß, wenn noch Forderungen unter dem Titel »Reparationen« gegen
Deutschland erhoben werden sollten, die zu Zahlungsverpflichtungen führen, Deutschland nicht in der Lage sein würde, das Schuldenabkommen
zu erfüllen. Eine Schuldner- und Gläubigerstaaten bindende Vereinbarung über diesen Punkt konnte schon deswegen nicht getroffen werden, weil
das Reparationsproblem nicht Gegenstand der Schuldenkonferenz, sondern des Friedensvertrages oder ähnlicher Abkommen ist. Wichtig ist aber – und
darauf legten wir entscheidenden Wert – daß die Gläubiger und der Dreimächte-Ausschuß von jener Erklärung in genügendem Umfang Kenntnis genommen haben.
Welche Bedeutung die Reparationen im Zusammenhang mit dem Schuldenabkommen haben, geht aus folgendem Umstand hervor:
Wir haben in London die Nachkriegs- und Vorkriegsschulden zu regeln
gesucht und dies auch zustande gebracht. Nur bei wenigen Ländern fällt aber der Beginn der Nachkriegszeit mit dem Ende der Vorkriegszeit
zusammen, z. B. bei der Schweiz. Gegenüber den Ländern, die am Kriege beteiligt waren, sind Schulden aus Anlaß des Krieges entstanden. Wegen
dieser Schulden haben 19 Länder im Jahre 1946 das sogenannte Pariser Reparationsabkommen abgeschlossen und sich aus bestimmten deutschen
Vermögenswerten für ihre Forderungen, die sie gegen Deutschland hatten, befriedigt – es handelt sich hierbei insbesondere um das deutsche
Auslandsvermögen. Wem dies nicht schon deutlich war, dem muß es durch die sehr anerkennenswerte Arbeit der Studiengesellschaft für
privatrechtliche Auslandsinteressen über Fragen des Auslandsvermögens klar geworden sein – aber auch durch die Demontagen und Wegnahmen aus
Deutschland. Diese im Kriege entstandenen Schulden, die hauptsächlich in den Verrechnungskonten Niederschlag gefunden haben, umfassen sehr
große Beträge. Allein den Ländern außerhalb des Eisernen Vorhanges schuldet Deutschland aus der Kriegszeit über 20 Milliarden RM, und dazu
kommen noch die Forderungen und Guthaben solcher Länder, mit denen wir kein Verrechnungsabkommen unterhielten, wie zum Beispiel Holland, das
allein eine Forderung von 3 Milliarden RM aus im Kriege entstandenen Guthaben bei der Reichsbank in Berlin hatte. Nun könnte man sagen, das sind ja nur Reichsmarkbeträge. Aber die Verrechnungsabkommen
bestimmten, daß der Verrechnungspartner die Forderungen in seiner Valuta führte und wir in unserer, also in RM. Unsere Erklärung an die Gläubiger ging,
wie schon erwähnt, dahin, daß nicht von uns erwartet und verlangt werden darf, unter dem Titel Schulden aus dem Kriege noch Forderungen zu erfüllen, denn dann würden die Verpflichtungen aus dem Londoner
Schuldenabkommen unerfüllbar werden.
Ich komme nun zurück auf die jährlichen 567 Millionen DM, die wir für die
Dauer von fünf Jahren zu leisten haben, ehe sich dieser Betrag ab 1958 auf etwa 365 Millionen DM erhöht. Ich nenne Ihnen nur diese rohen Ziffern, um
die Dinge nicht zu kompliziert zu machen. Aber ich kann kein Schuldenabkommen darstellen, ohne Ziffern zu bringen. Allerdings gibt es Schuldner, die über Schulden reden und nicht bereit sind, ihren
Nichtzahlungswillen mit Ziffern zu belegen.
Die 567 Millionen DM betreffen drei Währungsräume, den EZU-Raum, den
Dollar-Raum und das »Übrige«. Das »Übrige« soll hier nicht näher behandelt werden, denn der Betrag macht nur 4% vom Ganzen aus. Während der
ersten Fünfjahres-Periode entfallen rd. 60% auf den EZU-Raum und 40% auf den Dollar-Raum, und ab 1958 entfallen wiederum nur wenige Prozent
auf die übrige Welt und je etwa 50% auf den Dollar-und den EZU-Raum.
Nun sind wir im Augenblick optimistisch hinsichtlich unserer Verpflichtungen
gegenüber dem EZU-Raum. Ich halte die Europäische Zahlungs-Union für eine sehr gute Einrichtung, und ich bin nicht so kühn zu verlangen, daß
dieser Rahmen gesprengt werde, um uns über diesen Zahlungsmechanismus hinwegzusetzen. Die Nachrichten über die monatlichen Saldenüberschüsse,
die im März, April, Mai, Juni und Juli 1952 in London eintrafen, während wir über die Schulden verhandelten, waren für uns Katastrophennachrichten,
und wir hörten mit Schrecken jeweils zu Monatsanfang: Deutschland hatte 83, 78 und dann 87 Mill. $ Überschuß im Monat. Hinzu kam am 21. 6. 1952
– anläßlich des vierten Jahrestages der Währungsreform – die Mitteilung der Bundesregierung, die voller Stolz darlegte, daß sich in den vergangenen vier
Jahren unsere Exporte versiebenfacht und unser Lebensstandard wieder Friedenshöhe erreicht hätte, daß wir einen Verteidigungsbeitrag ohne
Steuererhöhungen leisten würden und daß, falls eine Steueränderung in Frage käme, es sich nur um Steuerermäßigungen handeln könne. Selbstverständlich wurden uns solche Äußerungen von den Gläubigern
vorgehalten, worauf man nur erwidern konnte, daß wir ein demokratisches Land sind und eine demokratische Regierung haben, die im nächsten Jahr neugewählt würde.
Wir dürfen nun nicht nur aus der guten Entwicklung der EZU während des
Jahres 1952 den Schluß ziehen, daß dies immer so bleiben wird. Ich erinnere an England, das im Jahre 1951 eine starke Gläubigerposition in der EZU
hatte – man sprach allgemein von einer Aufwertung des Pfundes –, und es dauerte noch nicht fünf oder sechs Monate, da sank die starke
Gläubigerposition ab, und man sprach allgemein von einer erneut notwendig werdenden Abwertung des Pfundes.
Schlimmer aber als im EZU-Raum ist naturgemäß die Situation im
Dollar-Raum, denn auch ohne Schuldendienst haben wir dort eine defizitäre Lage. Der uns von den USA zugestandene Aufschub der Tilgungen für die
Nachkriegshilfe von 92 Millionen DM stellt zwar eine nicht unwesentliche Erleichterung dar. Aber es bleiben neben den laufenden Zahlungen aus dem
Güter- und Dienstleistungsverkehr noch erhebliche Transferverpflichtungen im Rahmen des Londoner Abkommens übrig. Nicht nur die Bundesrepublik,
sondern Europa als ganzes ist, wie Sie alle wissen, knapp an Dollar. Man hat ausgerechnet, daß Gesamtwesteuropa diesseits des Eisernen Vorhanges ein
Jahres-Dollardefizit von 3,7 Milliarden hat. Von diesem haben wir mit oder ohne Schuldendienst etwa 4 1/2 oder 6% für unsere Rechnung zu buchen.
Die anderen Länder, größer und bedeutender in ihrer Volkswirtschaft, haben also einen wesentlich höheren Anteil an dem erwähnten Dollardefizit.
Amerika hat bisher das Defizit durch großzügige Behandlung Europas überbrückt, durch Geschenke, durch Kredite mit teilweisen Streichungen,
für die Anerkennung entgegenzubringen wir nicht nachlassen dürfen. Ein Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ohne diese großzügige Behandlung
und ohne die segensreiche Wirkung der Counterpart-Funds ist überhaupt nicht vorstellbar.
Die Engländer haben jüngst und wiederholt verlangt und vorgeschlagen:
Handel statt Hilfe – »Trade instead of Aid«. Es mag sein, daß darin eine Lösung liegt. Aber so einfach sind die Dinge nicht, und es bleibt der
zukünftigen Entwidclung überlassen, ob es bei unvermindertem und unverändertem Interesse Amerikas am Wohlergehen Europas und an den Vorgängen in Europa möglich ist, daß Amerika auch unter Fortsetzung der
großzügigen Behandlung der europäischen Probleme die Lösung finden oder dazu beitragen wird, das Defizit in Dollar zu decken. Ich wiederhole also:
40% von 567 Millionen DM sind knapp 55 Millionen Dollar und 50% von 765 Millionen DM sind ungefähr 90 Millionen Dollar, die wir jährlich mehr decken
müssen, als uns ohnehin schon zu decken übrigbleibt, d. h. selbst nach 1958 ist das jährliche Dollar-Soll etwa, um eine leicht ausrechenbare Größe
zu nennen, 50% der von uns im vergangenen Jahr importierten USA-Kohle. Auf die Folge dieser skeptisch zu beurteilenden Transferlage im Dollar-Raum komme ich im Laufe meiner Ausführungen noch zurück.
Ich komme nun zur Darlegung eines wichtigen Moments: zur Schuldenregelung selbst. Ihnen eine geschlossene Darstellung aller
Regelungen zu geben, würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen. Ich möchte lieber einzelne Typen der Regelung herausgreifen, um Sie Ihnen zu
erläutern und an ihrer Hand die Probleme und die Kritik zu entwickeln, die mit dem Schuldenabkommen verbunden sind.
Die Schuldenregelung selbst ist in 4 Hauptgruppen vor sich gegangen:
Die 1. Hauptgruppe befaßt sich mit den Staatsschulden, den Länderschulden, denen der Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen
Rechts des Deutschen Reiches, der Reichspost, der Reichsbahn usw.
Die 2. Hauptgruppe betrifft die Behandlung der privaten Industrie-Anleihen, aufgenommen von deutschen Industrieschuldnern.
Die 3. Hauptgruppe behandelt die Stillhalteschulden und
Die 4. Hauptgruppe alles übrige, was man nicht in den ersten drei Gruppen unterbringen kann.
Bei der Frage der Staatsschulden nahm die wichtigste Stelle die Regelung
der größeren Anleihen ein: der Dawes-Anleihe, der Young-Anleihe und der schwedischen Zündholzanleihe.
Bei der Dawes-Anleihe zum Beispiel haben die neutralen Obligationäre,
Schweden und die Schweiz, bis zum Schluß des Krieges ihre Kupons zu den damals noch gültigen Sätzen eingelöst erhalten, und es haben zunächst die
anderen Gläubiger verlangt, daß sie mit diesen Ländern gleichziehen. Man hat daher zugestanden, auf einer ermäßigten Zinsbasis – statt 3% nur 5% –
den Gläubigern eine Fundierungsanleihe zu geben, die selbst 20 Jahre läuft, mit 3% verzinslich ist und ab 1958 mit 2% amortisiert wird. Ferner hat man
dem Obligationär, um ein Zahlenbeispiel zu geben, für seine alte 1000 Dollar 7%ige Dawes-Anleihe eine neue 1000 Dollar 5%ige – bei der amerikanischen Tranche 5 1/2%ige – Dawes-Anleihe eingeräumt, die ab
1958 mit grundsätzlich 2% jährlich zu amortisieren ist. Die Fälligkeit dieser Anleihe wurde bis zum Jahre 1969 hinausgeschoben. Die Zahlung der
rückständigen Zinsen für die Periode vom 1. Januar 1945 bis 1953 wurde offengelassen, ein Punkt, auf den ich noch zurückkomme. Die vorhin erwähnte Ermäßigung der Zinsen von 7% auf 5% ist dabei nicht
berücksichtigt. Ebensowenig kommt bei dieser Berechnung zum Ausdruck, daß die durch das Londoner Abkommen vorgesehene Fundierungsanleihe
für jene 8-Jahreszinsperiode erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands gegeben wird und auch dann wiederum 20 Jahre mit 3% Verzinsung und
2% Amortisation läuft. Es kann wohl niemand behaupten, daß eine 20-jährige Anleihe, deren Schuldner Deutschland ist und die nur 3% Zinsen
trägt, pari wert ist. Das geht aus folgendem Beispiel hervor: bei den Verhandlungen mit den Franzosen über den Ausgleich einer Spitze haben
sich die französischen Gläubiger wegen eines 85-Franken-Anspruchs einer solchen Fundierungsanleihe mit einer Kassenzahlung von 30 Franken abfinden lassen.
Nun ist der Vorwurf erhoben worden, man habe in London versäumt, die
Tatsache der territorialen Beschränkung der Bundesrepublik durch Kürzung des Kapitals der Reichs- und preußischen Schulden zur Anerkennung zu bringen. Was ist daran richtig und was falsch gesehen?
Die Bundesregierung hat am 6. 3. 1951 eine Erklärung abgegeben, die die
eigentliche Grundlage für die Londoner Verhandlungen war. Hierin heißt es unter anderem: die Bundesrepublik erkennt an, für die Auslandsschulden
des Deutschen Reiches zu haften, und zwar nicht für einen Teil der Auslandsschulden, sondern schlechthin.
Die Uberlegung für diese Haftungsübernahme ist folgende gewesen:
Die Bundesregierung hat – und diesmal mit voller Zustimmung der Opposition – den Standpunkt vertreten und vertritt ihn noch, daß die
Bundesrepublik mit dem Deutschen Reich identisch ist. Wäre die Bundesrepublik mit dem Deutschen Reich nicht identisch, dann könnten wir
auch nicht von unserem Saargebiet sprechen, denn es ist kein Zweifel, daß das Saargebiet niemals zur Bundesrepublik gehört hat, wohl aber zum
Deutschen Reich. Wir müssen uns die Frage vorlegen: wer ist denn zuständig und haftet außerhalb der Bundesrepublik für die Reichsschulden?
Etwa die volksdemokratischen Vertreter der Ostzone oder die Regierung der volksdemokratischen Republik? Sie sehen schon aus dieser Frage, daß eine
andere Erklärung als die der Identität der Bundesrepublik mit dem Deutschen Reich uns auf einen Irrweg geführt hätte. Es heißt nun in jener
Erklärung weiter, daß bei der Regelung der zu übernehmenden Schulden auf drei Faktoren Rücksicht genommen werden solle:
1. auf die finanzielle Lage der Bundesrepublik,
2. auf die Reduktion der wirtschaftlichen Potenz der Bundesrepublik und
3. auf die Auswirkungen der Beschränkung der territorialen Zuständigkeit der Bundesrepublik.
Dem zuletzt genannten Faktor ist wie folgt Rechnung getragen worden: die Bedienung eines Teils der öffentlichen Schuld wurde bis zur
Wiedervereinigung aufgeschoben. Es handelt sich in der Hauptsache um den Teil der rückständigen Zinsen in einer Gesamthöhe von etwa 1 Milliarde
DM, der acht, zum Teil erheblich mehr Jahre umfaßt. Am Beispiel der Dawes-Anleihe, bei der die Zinsrückstände von 1945 – 53 aufgeschoben
wurden, können Sie erkennen, wie sich der Territorialfaktor rechnerisch auswirkt: 8 Jahre zu 5% bedeuten 40%. Addiert man diese 40%, die nicht
belegt werden und bis nach der Wiedervereinigung Deutschlands unbedient bleiben, mit 100% Kapital, so ergibt sich: 40 zu 140 = 28,5%. Mit diesem
Prozentsatz ist also dem Territorialfaktor Rechnung getragen worden. Bei der bis 1980 laufenden Young-Anleihe, deren Zinssatz grundsätzlich auf 4
1/2% reduziert worden ist, ergibt sich für den Territorialfaktor ein geringfügig niedrigerer Prozentsatz als bei den Dawes-Bonds. Bei einer Reihe
von Schuldenkategorien, so z. B. beim Lee-Higginson-Kredit, haben wir statt des Zinsaufschubs bis zur Wiedervereinigung sogar eine endgültige
Streichung der rückständigen Zinsen erreicht. Bei der sogenannten Schweizer Clearing-Milliarde konnte sogar eine etwa 50%ige Reduzierung der Kapitalsumme erzielt werden.
Was die Wiedervereinigung selbst bedeutet, haben wir nicht zu definieren
versucht, denn das hat auch der Deutschland-Vertrag nicht getan, und warum sollten wir weitsichtiger zu sein versuchen, als es Deutschland und
die Alliierten bei der Konzeption des Deutschland-Vertrages gewesen sind? Die Presse der Ostzone hat sich darüber mit Wohlgefallen geäußert, daß wir
auch noch den Schuldenanteil des Ostens übernommen haben. Wenn man sich darüber freut, daß jemand anderes die Schulden zahlt – so denkt
nämlich die Ostzone, wir dagegen fühlen uns identisch mit unserem Osten –, dann scheint mir dort doch der Gedanke vorzuherrschen, daß man nicht
an eine Wiedervereinigung glaubt oder sie wünscht. Da wir ebensosehr daran glauben wie wir es wünschen, so ist es, glaube ich, weise gewesen,
sich schon jetzt mit dem Schuldenausmaß zu befassen und eine Regelung vorab zu treffen, die notwendig ist, wenn der Tag der Wiedervereinigung kommt.
Die zur 1. Hauptgruppe gehörigen, auf Fremdwährung lautenden Staats-
und Gemeindeanleihen sind wie folgt geregelt worden: für die rückwärtige Zeit werden die aufgelaufenen Zinsen unter Festsetzung eines Minimal- und
Maximalsatzes um 1/3 auf 2/3 der ursprünglichen oder durch echte Konversion herabgesetzten Sätze ermäßigt. Diese so auf 2/3 ermäßigten
Zinsen werden zusammen mit dem Kapital der Anleihe auf 20 Jahre von der alten Fälligkeit ab fundiert, und die laufenden Zinsen werden unter Abzug
von 1/4 des Satzes mit 3/4 des Original-Vertragssatzes in Zukunft verzinst. Die Tilgung setzt bis 1958 aus und beginnt im Jahre 1958 mit 1%, und falls
die Anleihe noch solange läuft, wird diese Amortisation ab 1963 auf 2% erhöht. Diese Regelung gilt für alle Staats- und Gemeindeanleihen, wenn
man von den äußeren Anleihen Preußens absieht, für die folgende besondere Lösung gefunden wurde: Preußen ist ein Staat, der durch Kontrollratsgesetzgebung aufgelöst wurde. Damals dachte man nicht an die
Schulden dieses Landes, und ich glaube, die meisten Militärs und Politiker jener Zeit haben niemals für möglich gehalten, daß Deutschland noch einmal
Schulden bezahlen würde, könnte, sollte oder müßte. Inzwischen hat man festgestellt, daß Preußen doch noch Schulden hatte, nämlich zwei
Dollaranleihen und noch eine ganz kleine Anleihe der Stadt Lübeck, die von Preußen übernommen wurde. Die Bundesregierung hat sich nun verpflichtet, für Rechnung der Nachfolgeländer Preußens dessen
Verpflichtungen zu übernehmen. Auch hier sind wir den Weg gegangen, für eine Obligation von je 1000 Dollar eine 1000-Dollar-Obligation durch die
Bundesrepublik zu emittieren. Wieviel von Preußen dem Gewichte nach in das Gebiet der Bundesrepublik gefallen ist, läßt sich schwer sagen. Man kann
den Anteil statistisch zwischen 39 und 51% bestimmen. Tatsache ist, daß die Kupons seit 1935 nicht bedient wurden. Nach der getroffenen Regelung
werden die Kupons vom 1. 1. 1933 bis 31. 12. 1952, bzw. für den entsprechenden Zeitraum, gemessen an den Kuponstichtagen, niedergeschlagen und können von den Gläubigern erst dann präsentiert
werden, wenn sie aus dem östlichen Teil des Gebietes Preußens wieder einen zahlungsfähigen Schuldner oder Kontrahenten sich gegenüber haben.
Da dieses Niederschlagen der Zinsen uns nicht ausreichend zu sein schien, haben wir außerdem den laufenden Zinssatz heruntergesetzt, nämlich nicht
auf die üblichen 3/4& der Kontraktzinsen, das wären 4 7/8% für die eine, oder 4 1/2% für die andere Anleihe gewesen, sondern 4%. Gleichzeitig
wurde festgelegt, daß die Tilgung nicht durch Auslosung, wie ursprünglich im Vertrag steht, sondern durch Rückkauf erfolgt.
In der Frage der Staatsanleihen spielen ferner eine Rolle die Reichsmarkanleihen des ehemaligen Reiches. Bei den Reichsmarkanleihen,
die in ausländischem Besitz sind – die Ziffer steht nicht genau fest, es ist aber ein Milliardenbetrag – haben wir den Ausländern Inländerbehandlung
zugesagt. Jeder von uns weiß, wie schlecht der Inländer mit seinem Schatzanweisungsbesitz behandelt worden ist. Allerdings ist in Aussicht genommen, daß sich die Ausländer eine erneute Verhandlung mit
Deutschland vor dem 1. April 1954 vorbehalten, wenn eine gesetzliche Regelung dieser Frage bis Ende 1953 nicht erfolgt ist.
Bei der Regelung der Staatsschulden nun mußte eine Reihe von Schulden
geregelt werden, die wir in unserem Angebot vom 23. 5. 1952 nicht berücksichtigt hatten. Das waren insbesondere solche, die wir aus taktischen Gründen mit dem Vermerk versehen hatten: »werden nicht
bedient« – »fallen unter Kriegsschulden« – »werden 10:1 abgewertet« oder die wir ganz ohne Vermerk einfach offengelassen hatten.
Hierunter befindet sich eine große Reihe von Schulden, die inzwischen
doch geregelt werden mußten. Als eine wichtige Kategorie dieser Art nenne ich die Forderungen der sogenannten Mixed Claims Commission. Der
Rechtsgrund für diese Forderungen lag in Schäden und Sabotageakten, die Deutsche 1917 in Amerika verursacht hatten. Sie mußten nach Durchführung eines Prozesses von Deutschland anerkannt werden. Der
Generalstaatsanwalt in diesem Prozeß war übrigens Mc Cloy; dies war das erste Mal, daß er sich mit Deutschland – damals als Staatsanwalt und
erfolgreich – befaßt hat. Insoweit diese Forderungen in Händen privater Berechtigter lagen und liegen, mußten sie mit in die Londoner
Verhandlungen einbezogen werden, und wir haben zugesagt, sie über eine Periode von 16 Jahren zu regeln.
Eine andere Forderung dieser Art lag in einem Anspruch Belgiens begründet, der daraus entstand, daß Deutschland im ersten Weltkrieg
Mark-Noten im Betrage von 6 Milliarden in Belgien in Umlauf gebracht hatte. In einem Abkommen Ende der 20er Jahre wurde diese Schuld in einer Höhe
von 680 Millionen RM verbrieft. Aus dieser Zahlung, die Ende der 30er Jahre nicht mehr voll geleistet wurde, sind Beträge in die Konversionskasse
eingezahlt worden, und wir haben uns Belgien gegenüber zu einer Zahlung von 40 Millionen DM, die in acht Jahren zu leisten ist, verpflichtet.
Unter diesen Abschnitt fällt vor allem die Schuldenregelung für äußere
Anleihen Österreichs. In der Erklärung der Bundesregierung vom 6. 3. 1951 hat Deutschland die Verantwortung für die auf Österreich fallenden Zinsen
und Kosten für die Periode von März 1938 bis zum Schluß des Krieges 1945 übernommen. Dies würde eine Schuld von etwa 35 Millionen DM ausmachen. Bei den Verhandlungen verstanden plötzlich die
Gläubigervertreter unter »Kosten« auch die Amortisation, während wir als Kosten nur die üblichen Gebühren – die bei den Banken üblichen Gebühren
– bezeichneten, also sehr viel weniger. Wir haben in dieser Frage eine Einigung erzielt, die dahingeht, daB wir über einen Zeitraum von 15 Jahren
an die Garantiemächte der äußeren Anleihe Österreichs bestimmte Zahlungen leisten und für andere äußere Anleihen Österreichs im Laufe von
10 Jahren bestimmte Verpflichtungen übernehmen. Auch hier finden Sie eine interessante Rechnung: wir haben zum Beispiel die Verpflichtung übernehmen müssen, für den Anteil Österreichs an Zinsen und
Amortisationen der Caisse-Commune-Werte einzustehen. Diese »Caisse Commune« diente der Schuldenabwicklung der österreichisch-ungarischen Monarchie nach dem Zusammenbruch 1918.
In Gold gerechnet hätte unser Anteil an Zinsen und Kosten der Österreich-Anleihen aus der Periode 1938 – 1945 eine Summe von 10,5
Millionen DM ausgemacht. Unter Abschlag des Goldfaktors reduziert sich die Forderung auf 6,3 Millionen DM, und wir waren uns einig, diesen Betrag im
Laufe von 15 Jahren ohne Zinsen abzuzahlen. Da aber die hauptsächlich französischen Gläubiger eine schnellere Zahlung wünschten, haben wir nach
dieser getroffenen Absprache eine Vorverlegung der Fälligkeit um fünf Jahre vorgenommen unter Abschlag eines Diskonts und kommen somit auf eine
Gesamtleistung von etwas über 4 Millionen DM. Dies nur als Beispiel dafür, daß bei einer Schuldenregelung nicht die Gesamtsumme allein entscheidend
ist, sondern auch die Frage des Hinausziehens der Fälligkeit und die Höhe der jährlich zu leistenden Zinsen und Amortisationen.
In diesem Zusammenhang ist die Konversionskasse von ganz besonderer
Bedeutung. Diese ist ein Instrument, das im Juni 1933 geschaffen wurde. Das Jahr 1933 wird im allgemeinen als ein besonderes Jahr angesehen, und
Einrichtungen aus dieser Zeit werden selten gutgeheißen. Die Vorwürfe der Gläubiger gegen die Konversionskasse beruhen hauptsächlich auf folgendem:
die Konversionskasse zog die Markgegenwerte der laufenden Zahlungsverpflichtungen der deutschen Schuldner an sich mit dem Versprechen, die Beträge zugunsten der Gläubiger zu konvertieren. Das tat
sie aber sehr bald nicht mehr; sie hatte keine Devisen, um einen solchen Transfer vorzunehmen. Die Bonds wurden dann im Preise billiger, aber die
Kasse und andere Einrichtungen hatten gleichwohl Devisen, um die so billig gewordenen Bonds zurückzukaufen. Es gibt eine Reihe von Ländern, die in
der Geschichte des Kapitals ähnliche Methoden angewandt haben. Es wäre unhöflich von mir als Schuldner, solche Länder mit Namen zu nennen. Diese
Einrichtung mußte beseitigt werden, und die Lösung, die die Wirtschaft außerordentlich erschreckt, sieht wie folgt aus: der Schuldner soll ein
zweites Mal zahlen, und zwar alle diejenigen Beträge, die in die Kasse eingezahlt wurden, aber nicht in die Hand des Gläubigers gekommen sind.
Nun ist jedoch zunächst und zwar generell eine Einigung erzielt worden, wonach die rückwärtigen Zinsen um 1/3 auf 2/3 gesenkt werden. Der Schuldner braucht also nicht 3/3 zu zahlen, sondern nur 2/3.
Zur Begründung dieser Doppelzahlung wird u, a. folgendes angeführt: zwar
kann sich der Schuldner, soweit er Verpflichtungen hat, die ausländischem Recht unterliegen, nach dem innerdeutschen Recht der Konversionskassen-Regelung auf die schuldbefreiende Wirkung seiner
Zahlungen an diese Kasse berufen – der ausländische Gläubiger kann jedoch im Ausland den ausländischen Rechtscharakter des Anleihevertrages ins Feld
führen, womit die Berufung des Schuldners auf die schuldbefreiende Wirkung seiner Zahlungen nicht den gleichen Effekt noch den gleichen
Erfolg hat. Nun ist aber vorgesehen, daß die Bundesrepublik alle Beträge, die ein Schuldner zum zweiten Mal zahlt, diesem voll erstatten soll. Dazu ist
die Bundesrepublik verpflichtet, da sie – nicht sie selbst, aber das Deutsche Reich – auf Grund eines deutschen Gesetzes den Schuldner verpflichtet
hatte, an die Konversionskasse, und zwar mit schuldbefreiender Wirkung, zu zahlen.
Die für die Abwicklung der Konversionskasse zuständige Stelle findet darin
einen gewissen Trost, daß die Konversionskasse über Bestände an deutschen Auslandsbonds verfügt, die im Zuge der Wertpapierbereinigung zugunsten des Schuldners untergehen werden. Indessen gehen die
Ansprüche aus diesen Posten nicht unter; diese Beträge kann die Bundesrepublik daher als Abwickler der Konversionskasse dem Schuldner zur Verrechnung bringen.
Man könnte fragen, warum zahlt nicht die Bundesrepublik selbst? Diese
Lösung hätte eine Reihe unangenehmer Rechtsfragen aufgeworfen; vor allem hätten wir dann für die Einzahlungen aus der Ostzone in die
Konversionskasse geradestehen müssen. So bleiben aber die Leistungen auf die Einzahlungen der westdeutschen Schuldner beschränkt.
Neben der Konversionskassen-Regelung besteht das Problem der Verrechnungskasse. Ich erwähnte die Verrechnungskasse schon im
Zusammenhang mit den Kriegsschulden, als ich den Betrag von 20 Milliarden nannte. Vor allem im Verhältnis Deutschland-Frankreich sind vor
Kriegsausbruch noch eine Reihe von Einzahlungen der Schuldner erfolgt, die den Gläubiger nicht mehr erreicht haben. Es ergaben sich daraus Ansprüche
französischer Gläubiger in einem Ausmaß von fast 3 Milliarden Franken oder mehr als 80 Millionen DM, die angemeldet wurden. Bei den Verhandlungen
wurde erreicht, daß diese Summe auf etwa 1% ermäßigt wird, und die Bundesrepublik hat es übernommen, durch Zahlung eines Pauschalbetrages
diesen Fall aus der Welt zu schaffen, ohne auf den Originalschuldner zurückzugreifen. Diese Fälle von Zahlungen auf Verrechnungskonto sind
deshalb so schwierig, weil bei verschiedenen Verrechnungsabkommen die schuldbefreiende Wirkung der Zahlung vorgesehen war; bei anderen war sie
ausgeschlossen; es gab schließlich solche, bei denen darüber nichts ausgesagt wurde.
Der französische Fall ist in der Presse und von Juristen aufgegriffen worden.
Ich liebe Juristen, aber selten im Zusammenhang mit Schuldnern, und ich habe kürzlich einmal einigen Juristen – dies würde ich aber niemals dem
Schuldner gegenüber tun – erklärt, daß, wenn sie Hand in Hand mit dem Schuldner zu mir kommen, sie schon an der Haustür den Kredit verloren
haben. Das sage ich, wenn der Schuldner mit einem Juristen kommt; erscheint aber der Jurist mit einem Schuldner, so begrüße ich selbstverständlich den Juristen.
Eine Reihe von Ländern, die zu unseren Bundesgenossen gehörten, ist im
Friedensvertrag verpflichtet worden, auf alle Ansprüche gegen Deutschland zu verzichten, und wir möchten hoffen, daß diese Bestimmung der
Friedensverträge auch uns gegenüber aufrechterhalten bleibt. Das sind die Länder, die zum Teil jenseits, zum Teil diesseits des Eisernen Vorhanges
liegen. Dieses Problem kann nur länderweise und fallweise behandelt werden.
Ähnlich wie die Staats- und Gemeindeschulden sind die zur 2. Hauptgruppe
gehörigen Schulden aus Auslandsanleihen der deutschen Wirtschaft geregelt worden. Auch hier gilt die Regelung: 2/3 der rückständigen Zinsen,
3/4 der Kontraktzinsen bis zur Endfälligkeit, die neu zu vereinbaren ist. Die Laufzeit soll 10 – 25 Jahre betragen, wobei festgelegt ist, daß die längere
Laufzeit demjenigen Schuldner zugute kommt, der der Grundstoffindustrie angehört. Dies ist bei etwa 5/6 aller noch ausstehenden deutschen Auslandsanleihen der Fall.
Bei der Regelung dieser privaten Anleihen ist folgendes vorgesehen: der
Anleiheschuldner soll bis zum 30. 6. 1953 an die Adresse der Gläubiger ein Angebot machen, wie er sich im Rahmen der in London getroffenen
Regelung die zukünftige Gestaltung der Anleihe vorstellt. Dabei hat er sich mit seinem Emissionshaus, das ursprünglich einmal die Anleihe ausgegeben
hat, in Verbindung zu setzen, mit den Treuhändern, die die Sicherheiten verwalten und mit einer Vertretung der Obligationäre, die noch gefunden
werden muß. Und wenn er sich mit diesen über die Bedingungen der Offerte nicht einigen kann, so kann er einen Schiedsausschuß anrufen, der
aus vier Deutschen, je einem Amerikaner, Engländer, Holländer und Schweizer besteht; diese acht können sich, wenn sie es wünschen, einen
neutralen Neunten dazunehmen. In diesen Bestimmungen für die Anleihen ist ein Paragraph vorgesehen, der bei Härtefällen Anwendung findet, d. h.
dann, wenn durch Kriegsausgang oder Kriegsverluste im Osten – aber nicht nur auf solche Fälle beschränkt – dem Schuldner, ohne ihn finanziell zu
gefährden, nicht zugemutet werden kann, die vollen Verpflichtungen der Londoner Regelung zu erfüllen. Diese Härteklausel ist auch in der 4. Gruppe »alles übrige« eingeführt, die ich nannte.
Schwierig ist es nun für den Anleihe-Schuldner, sich jetzt schon damit zu
befassen, was geschieht, wenn der Gläubiger der angebotenen Regelung nicht zustimmt. Denn der Gläubiger kann und soll nicht gezwungen werden,
das Abkommen anzunehmen. Allerdings wird festgelegt werden, daß bei Nichtbeitritt der Gläubiger keine Bedienung, keinen Schuldendienst erhalten
kann, und ich möchte glauben, daß die in London vorgesehene Regelung günstig genug ist, um das Gros der Gläubiger dazu zu bewegen, das
Angebot anzunehmen. Diejenigen, die es nicht tun, könnten den Versuch machen, sich vor einem ausländischen Gericht einen Titel zu verschaffen, um
gegen den Schuldner oder gegen das ausländische Vermögen des Schuldners vorzugehen. Nun sind wir zunächst durch die Wegnahme des deutschen Auslandsvermögens vor dieser Gefahr etwas geschützt, aber ich
denke an den Fall, daß ein solches Vermögen neu entsteht. Der Gläubiger müßte aber erst einen Titel haben, und es ist die Frage, ob ihm die
ausländischen Gerichte ohne weiteres diesen Titel verschaffen werden, denn wir fußen ja auf einem internationalen Abkommen, das wir jetzt
treffen werden und das vor den Parlamenten sehr vieler Länder, ich nenne insbesondere die Vereinigten Staaten, zur Kenntnis genommen, sprich:
ratifiziert werden wird. Ich möchte schon glauben, daß dann dieses Abkommen Teil des »ordre public« wird und diesem nicht widerspricht. Will
der Gläubiger aber in Deutschland auf Grund eines Titels vollstrecken, der draußen erworben wurde, so braucht er wiederum die Hilfe der deutschen
Gerichte, die er nur finden kann, wenn er sich der Regelung des Abkommens unterwirft. Er kann also nicht mehr bekommen, als er auch durch freiwilligen Beitritt erhalten kann.
Nun ist die Sorge der Schuldner folgende – und ich nenne mit Vorliebe die
Punkte, die kritisiert werden: wenn in Zukunft einmal neue Schwierigkeiten entstehen, wie kann der Schuldner vor einem neuen »default« geschützt
werden, vor den Folgen eines neuen Verzuges? Es ist, wenn man gerade seine Schulden regelt, die 20 Jahre ungeregelt blieben und zum Teil 14 –
18 Jahre nicht bedient wurden, sehr unschön, den Versuch zu machen, schon gleich wieder davon zu sprechen: was geschieht, wenn wir das
nächste Mal nicht zahlen? Selbst wenn wir es vorbringen würden, so gäbe es kein Mittel der Vereinbarung, um die Folgen eines neuen Verzuges, der
Rechte der Gläubiger auslöst, von vornherein auszuschließen.
Es ist behauptet worden, wir hätten in London Zinseszinsen bewilligt. Ich
nehme an, daß es sich hier um Leute handelt, die noch nie Schuldner einer Bank gewesen sind, sonst würden sie aus einer unbezahlten Zins- und
Kapitalrechnung wissen, was Zinseszinsen sind; denn im Falle von Zinseszinsen verdoppelt sich bekanntlich das Kapital bei 4% in 13 Jahren,
während es sich bei einfachen Zinsen erst in 25 Jahren verdoppelt. Wir haben in London eine Regelung getroffen für die ungeregelten
rückwärtigen Zinsen, indem wir 2/3 dieser rückwärtigen Zinsen zum Kapital schlagen und für diese gefundene neue Summe eine Fundierungsanleihe mit
einer neuen Laufzeit ausgeben, die natürlich verzinst und amortisiert werden soll. Man könnte stattdessen aber auch bar zahlen. Dies will der Schuldner
jedoch nicht – er will nach meiner Erfahrung nie gerne zahlen. Es gibt allerdings Ausnahmen. Aber selbst wenn der Schuldner das wünschte,
würde dies am Transferproblem scheitern. Folglich war es die Aufgabe, die Verpflichtungen über längere Zeiträume hinauszuschieben.
Man hat nun kritisiert, die Zinsen seien zu hoch, die wir in Zukunft zu
zahlen haben, nämlich 3/4 der Originalkontraktzinsen. Ich kenne einen Schuldner, der mir erklärt hat: »Das ist für mich untragbar«. Der Zufall
wollte, daß dieser Schuldner eine Aufforderung von seinem Gläubiger in Amerika erhielt: »Zahle doch in DM auf Sperrkonto, das würde mir
konvenieren. Und ich bin bereit, wenn Verluste entstehen, nämlich Verluste auf die Sperrmark, diese in Kauf zu nehmen.« Der Schuldner schrieb einen
Brief: »Ihre Mitteilung habe ich erhalten, aber aus grundsätzlichen Erwägungen möchte ich Ihrer Anregung nicht stattgeben. Hochachtungsvoll!« Der Gläubiger kam auf den klugen Gedanken, mich zu
befragen; ich setzte mich mit dem Schuldner in Verbindung – zufällig war es der gleiche, der sagte, daß die Zinsen zu hoch seien und er sie nicht
bezahlen könne. Ich sagte ihm: »Warum machen Sie nicht Gebrauch von der Gelegenheit, in Mark zu zahlen, wenn der Gläubiger schon den Verlust
auf sich nimmt?« Hierauf antwortete der Schuldner: »Aber um Himmels willen, warum soll ich einen so billigen Kredit zurückzahlen?«. Ich nehme an,
er hatte nicht ein so gutes Gedächtnis wie ich in diesem Falle und dachte, der wird das nicht merken. Aber nur eines von beiden kann stimmen,
entweder die Kritik am zu hohen Zinsfuß, nämlich 3/4 der Kontraktzinsen – das sind bei Anleihen im Durchschnitt zwischen 4 und maximal 5 1/4% –
oder der Schuldner hat sich inzwischen erinnert, daß es in Deutschland Kredite für Investitionszwecke mittel- oder langfristiger Art gibt, bei denen
man bis jetzt nur in Wunschträumen von 4 bis 5 1/4, 4 3/8, 3 1/4 und 2 1/2% und noch niedrigeren Zinssätzen spricht, als sie in London verabredet wurden.
Es gibt bei den Anleihen ein weiteres Problem, das vielleicht auch für Sie
von Interesse ist: jeder von Ihnen wird sich schon ausgerechnet haben, daß eine Anleihe, die mit einem relativ geringen Satz von 1 oder 2% jährlich
getilgt wird, aber im ganzen nur 20 Jahre läuft, am Ende dieser Zeit mit einem Restbetrag ungetilgt bleibt – selbst unter Einrechnung der ersparten
Zinsen. Die Amerikaner nennen diesen ungetilgten Betrag »balloon«. Bei der Zündholzanleihe haben wir zwar die Laufzeit der Anleihe so abgestellt, daß
mit jährlicher Amortisation ab 1958 plus ersparter Zinsen bei Ablauf der Anleihe im Jahre 1994 nichts zu tilgen übrig ist. Bei einer Reihe anderer Anleihen bleiben jedoch am Endtermin noch Beträge übrig.
Diejenigen Schuldner, die bei Endfälligkeit Beträge aufzubringen haben, befürchten nun, daß bei der Aufbringung und beim Transfer
unüberwindliche Schwierigkeiten entstehen könnten. Dieser Zustand tritt mit geringeren Beträgen 1965, mit größeren Beträgen jährlich ab 1968 bis
1978 ein. Ich gehöre nun zu denen, die sich darüber nicht so viel Sorgen machen. Und weshalb? Zunächst gibt es niemals einen Zustand, in dem ein
Land, das mit der Weltwirtschaft verflochten und in ihr tätig ist, völlig schuldenfrei bleibt. Schulden wird es immer geben. Nur möchte ich für
Deutschland den Zustand herbeiführen, geregelte – sprich: bediente – Schulden zu haben.
Zweitens: Wenn dieser Tag eintritt – zum Beispiel für eine Reihe von
Anleihen im Jahre 1968 – so werden sich für den Transfer, wenn bis dahin die Zusagen Professor Erhards erfüllt sind, keine Schwierigkeiten ergeben.
Drittens: Wenn Schuldner und Bund zu den Endfälligkeiten nicht in vollem
Umfange zahlen können, so dürfte unsere Kreditfähigkeit bis dahin hoffentlich so weit wiederhergestellt sein – ich persönlich glaube, dies wird
schon früher der Fall sein –, daß für diese individuellen Schulden eine neue Regelung gefunden werden kann, mit der die Anleihen auf weitere fünf
oder zehn Jahre zu günstigeren Bedingungen erstreckt werden, und zwar zu solchen, die den dann gültigen Sätzen entsprechen.
Sollten wir unseren Kredit bis zu den fraglichen Zeitpunkten nicht so weit
haben wiederherstellen können, dann bleibt abzuwarten, wie wir – und zwar möglichst rechtzeitig vor dem Eintritt der Endfälligkeiten – in Verhandlungen mit den Gläubigern oder im Rahmen der allgemeinen
Konsultation eine anderweitige Regelung und Bedienung der Anleihen vereinbaren können.
Die nächste Hauptgruppe der Londoner Regelung ist die der
Stillhaltekredite. Das neue Stillhalteabkommen, das zunächst ein Jahr läuft, stellt die Fortsetzung der unter diesem Namen schon vor über 20 Jahren
getroffenen und jeweils von Jahr zu Jahr verlängerten Vereinbarungen mit den ausländischen Bankgläubigern dar. Im Stillhalteabkommen ist die
kurzfristige Verpflichtung der deutschen Wirtschaft geregelt, insbesondere die der Banken, die im Jahre 1931 den ausländischen Bankinstituten
gegenüber in einer großen Zahl von Ländern mit über 7 Milliarden RM verschuldet waren. Die Gläubiger kamen aus England, Frankreich, Belgien,
Holland, Dänemark, Schweden, der Tschechoslowakei, der Schweiz, Italien und Amerika. Durch zwischenzeitliche Abdeckung dieser Schulden sind als
Gläubigerländer nur noch Amerika, die Schweiz und England übriggeblieben. Der Gesamtbetrag der noch ausstehenden Schulden macht noch etwa 350
Millionen DM aus, soweit sie die Verpflichtungen von Schuldnern in der Bundesrepublik betreffen; zu diesem Betrag sind die nicht bezahlten Zinsen
hinzuzurechnen. 90% der Schulden im Falle Amerikas und Englands lasten auf Banken. Im Falle der Schweiz besteht eine größere Anzahl von Direktschulden der deutschen Wirtschaft.
Eine Bank, die sich etwa auf die Ausnutzung der Freiwilligkeit der
Rückzahlung beruft, wie dies nach dem deutschen Devisenrecht heute noch vorgesehen ist, hat im selben Augenblick aufgehört, eine Bank oder ein
Bankier zu sein. Sie erwarten ebenfalls von einer Bank, daß sie ihre Sichteinlagen bei Fälligkeit zahlt. Sie wären mit Recht sehr entrüstet, wenn
eine Bank es versuchen sollte, sich dieser Verpflichtung unter Berufung auf die Freiwilligkeit als Voraussetzung für eine Auszahlung zu entziehen.
Gewisse Schuldner, die sich allzu sehr der Erfahrung des Umstellungssatzes der Währungsreform von 10:1 erinnern, sind sichtlich entrüstet, daß bei in
Devisen ausgedrückten Schulden dieses Spiel nicht funktioniert. Ich bekam dieser Tage einen Brief, in dem sich ein Schuldner mit folgenden Worten
beklagt: »Ich schulde Gulden und habe mit Entsetzen von der Regelung in London Kenntnis genommen. Ich hatte geglaubt, daß ich diese Schulden
mit einer Aufwertung 1:10 erledigen könnte.« »Aufwertung«, las ich – eine neue Form, eine Abwertung zu bezeichnen.
In dem Stillhalteabkommen – und dies gilt in erster Linie für die Fälle der
Direktschulden – ist eines nicht enthalten, das ist die Härteklausel. Ich gebe zu, daß es unter den Direktschuldnern und auch den Zweitschuldnern, die
nicht Banken sind, Fälle gibt, bei dien eine Zahlung der vollen Schuldsumme nicht zumutbar ist, ebenso wie bei Schuldnern der 2. und 4. Hauptgruppe. Solche Fälle sind jedoch äußerst selten.
Daß eine Härteklausel im Stillhalteabkommen noch nicht verankert ist, hat
folgende Bewandtnis: das Abkommen war bereits im Juni 1952 als erstes abgeschlossen worden, aus dem einfachen Grund, weil es sich bei
Schuldnern und Gläubigern des Stillhaltekomplexes um »professionals« – um Berufsbankiers – handelt. Wer von Ihnen je einen Boxkampf mit angesehen
hat, der wird wissen, daß die Kämpfe zwischen »professionals« sehr viel unblutiger verlaufen als die Boxkämpfe zwischen Amateuren. Man kann sich
bei den Gläubigern, die Banken sind, darauf verlassen, daß sie mit Vernunft schon im eigenen Interesse die Härteklausel auch dann anwenden, wenn sie
im Abkommen nicht verankert ist. Das mögen Sie auch an folgendem erkennen: im Stillhalteabkommen ist verabredet, daß die Gläubiger Ausschüttungen aus dem deutschen Vermögen in England, die dort »ex
gratia« erfolgen, dem Schuldner gutzubringen haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn wir haben dies nur bei den Stillhaltegläubigern
erreicht. Der Leiter der englischen Delegation ist zur Rede gestellt worden, warum er diese Konzessionen den Deutschen gemacht habe. Bekanntlich ist
es im Pariser Reparationsabkommen verboten, daß ein Land, welches Reparationen aus dem deutschen Auslandsvermögen erhält, diese zugunsten von Deutschen verwenden darf. Nur aus diesem Grunde hat die
englische Regierung, die diese Gelder nicht für sich selbst verwendet, sie aber den Gläubigern Deutschlands überantwortet hat, vorschreiben müssen,
sie dem Schuldner nicht gutzubringen. Der schon erwähnte Leiter der englischen Delegation hat die Antwort gegeben: »Den Deutschen eine Konzession gemacht? – Ich selbst habe die Aufnahme dieser Bestimmung
verlangt.«
Ich glaube also, es besteht kein Anlaß, daran zu zweifeln, daß man von
Gläubigerseite auf die echten Härtefälle Rücksicht nehmen wird. Im übrigen steht die Einfügung einer Härteklausel im Rahmen des Stillhaltekomplexes
bereits auf der Tagesordnung für die nächste Stillhaltesitzung.
Der Vollständigkeit halber muß ich an dieser Stelle auf ein noch nicht
gelöstes innerdeutsches Problem zu sprechen kommen, das mit dem Stillhaltekomplex zusammenhängt. Es handelt sich um die Schuldner, die
unmittelbar vor dem Krieg unter Benutzung ausländischer Rembourskredite Warenimporte finanzierten und diese, meist im Kriege bewirtschaftete,
Ware verkaufen mußten. Die Reichsmark-Erlöse sind ihnen, nicht zuletzt durch die Währungsreform, in den Händen zerronnen, und sie sind die
Rückzahlung auf die Kredite mit den aufgelaufenen Zinsen schuldig geblieben. Es besteht das Bemühen, aber noch kein Entschluß, für diese Schuldner Erleichterungen zu schaffen. Dies ist eine innerdeutsche
gesetzliche Angelegenheit. Zuständig ist das Finanzministerium. An diese Stelle sind in laufender Folge seit August 1950 Anregungen gemacht
worden. Ich bin mit den Vertretern dieser Schuldenkategorie einer Meinung, daß dieses Problem schleunigst bereinigt werden muß.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die getroffene Stillhalteregelung für
die deutsche Wirtschaft und Währung von der größten Bedeutung ist, weil die Abtragung der Schulden mit der Gewährung neuer kurzfristiger
Auslandskredite an die deutschen Import- und Exportfirmen verbunden ist. Ich halte die Tatsache, daß wir schon seit Jahr und Tag gezwungen sind,
unsere Importe an einem bestimmten Tag, wenn einmal Devisen für diesen Zweck zu verteilen sind, durchzuführen, für einen wesentlichen Verteuerungsfaktor für die rohstoffimportierende und -verbrauchende
Wirtschaft. Wenn wir nun mit Hilfe neuer Kredite den gesamten Import um 1 1/2% durch günstigen Einkauf, zu günstigen Bedingungen, auf dem
günstigsten Platz und zu dem günstigsten Zeitpunkt verbilligen könnten und im Export nur um 1 1/2% günstiger operieren, weil der Abnehmer wie der
Verlader eine besondere Kreditrisiko-Prämie Deutschlands einkalkuliert, so hätten wir bei unserem derzeitigen Außenhandelsvolumen den Gesamtschuldendienst aus der Londoner Regelung schon gedeckt. Ich
glaube, daß in diesem Moment die erste positive Folge der Wiederherstellung des deutschen Kredits liegt, wenn es dazu kommen sollte. Und davon bin ich überzeugt.
Die 4. und letzte Hauptgruppe ist die der sogenannten sonstigen Schulden. Sie umfaßt eine sehr große Summe. Es sind über 300 000
einzelne Schuldverhältnisse mit einem Gesamtbetrag von etwa 1,2 Milliarden DM aus Handelsgeschäften, aus alten Pensionsverträgen, aus
Sozialversicherungen, aus Vorauszahiungen ausländischer Besteller an die deutsche Industrie, aus dem kleinen und privaten Kapitalverkehr, aus
finanziellen Beziehungen zwischen ausländischen Muttergesellschaften und ihren ausländischen Töchtern sowie aus Honorarverträgen; ferner sind es
ausstehende Patent- und Lizenzgebühren, Anwaltskosten usw. Für diese Forderungen sind nun ganz bestimmte Regelungen aufgestellt worden, die etwa folgendes beinhalten: alte Handelsschulden und ähnliche
Verbindlichkeiten werden mit 1/3 alsbald gezahlt, die restlichen 2/3 in zehn Jahresraten, davon die fünf ersten Jahresraten ohne Zinsen. Die übrigen
Kategorien, so z. B. Schulden aus dem privaten Kapitalverkehr, sind innerhalb von 17 Jahren abzutragen. Auch hier gilt bis 1958 der Grundsatz:
wer Tilgung bekommt, erhält keine Zinsen, und wer Zinsen erhält, bekommt keine Tilgung. Hier mußte ein kompliziertes Schiedsgericht vorgesehen
werden, weil es denkbar ist, daß die Gläubiger und Schuldner sich nicht schnell über den einzuschlagenden Weg und die zu treffende Regelung einigen können. Während nun bei dem Stillhalteabkommen für den
Schuldner ein Beitrittszwang besteht, ist ein solcher für die übrigen Schuldner nicht gegeben. Der Gläubiger kann natürlich im Prozeßweg gegen
seinen Schuldner vorgehen. Aber er kann nicht mehr verlangen, als er im Falle des Beitritts zum Abkommen selbst würde verlangen können. Bei
diesen »übrigen« Handelsschulden sind nun wieder die Härteparagraphen und alle sonstigen Sicherungen eingebaut worden, die für die Abwicklung eines Schuldenabkommens vonnöten sind.
Bei einer zusammenfassenden Darstellung des Schuldenabkommens kommen wir zu folgenden Ziffern:
Die Gesamtvorkriegsschulden, die geregelt wurden, hätten auf Goldbasis nach den Anleiheverträgen gerechnet
etwa 13,5 Milliarden DM ausgemacht.
Nach Abschlag des Goldfaktors ergeben sich
etwa 9,6 Milliarden DM.
Die Londoner Einigung erfolgte auf der Basis von 7,3 Milliarden DM. Sie
sieht eine jährliche Leistung vor, die in den ersten 5 Jahren ungefähr 340 Millionen DM im Rahmen der genannten 567 Millionen ausmacht. Die
Differenz betrifft die Nachkriegsschulden. Nach fünf Jahren erhöht sich dieser Betrag auf etwa 360 – 380 Millionen jährlich.
Die Nachkriegsschulden hätten nach den ursprünglich gewährten Beträgen
etwa 16 Milliarden ausgemacht; sie sind reduziert auf 7 Milliarden. Wir haben also zwei Gruppen von Verpflichtungen in London behandelt.
1. 7 Milliarden DM für die Vorkriegszeit und
2. 7 Milliarden DM für die Nachkriegszeit.
Mit diesen 2 mal 7 Milliarden ist es aber nicht getan. Bekanntlich ist
inzwischen im Haag das Israel-Abkommen getroffen worden. Dieses sieht eine Leistung von 3,5 Milliarden DM vor. Der Betrag sollte nicht transferiert
werden – so heißt es im allgemeinen –, sondern durch Sachlieferungen geleistet werden. Nun gibt es eine ebenso wissenschaftlich wie politisch
begründete Meinung, nach der durch Sachlieferungen die Transferfähigkeit Deutschlands nicht geschmälert wird. Eine Ansicht, die ich nicht teilen kann.
Es müssen außerdem aber noch die Individual-Restitutions-Verpflichtungen
berücksichtigt werden, Diese machen mindestens noch einmal 3,5 Milliarden DM aus. Rechnet man sie zu dem Israel-Betrag hinzu, dann ergeben sich noch einmal 3 Milliarden DM.
Das ist noch nicht alles, meine Herren, denn es gibt noch Ausländervermögen in Deutschland, deren natürlichen Gegenposten früher
das deutsche Vermögen im Ausland bildete. Das deutsche Vermögen im Ausland ist von der Studiengesellschaft einmal auf 30 oder mindestens 20
Milliarden DM berechnet worden. Ich halte dies für einen sehr hohen Betrag, wenn ich berücksichtige, daß die gesamten Einkünfte im Jahre 1938, die
unter dem Titel Auslandsvermögen der deutschen Volkswirtschaft zugeflossen sind, den Betrag von 100 Millionen RM nicht überstiegen haben.
Es muß sich also um ein sehr schlechtes, unverzinsliches, ohne Dividende und Gewinn arbeitendes Auslandsvermögen gehandelt haben. Oder man
hat allen Gesetzen zum Trotz die Gewinne und Erträgnisse lieber im Ausland belassen, um den Verlust des Auslandsvermögens noch etwas zu erhöhen.
Das oben erwähnte ausländische Vermögen im Inland dürfte mindestens
noch einmal 7 Milliarden DM betragen. Mit Recht erwarten die ausländischen Eigentümer bald Zinsen, Mieten, Pachten, Dividenden und den Transfer
dieser Vermögenserträgnisse. Das sind – je nach dem wie Sie rechnen – auch nochmals vielleicht 300 – 400 Millionen DM im Jahr. Mir ist unerfindlich,
wie man – sei es auf Grund wirtschaftlicher oder politischer Uberlegungen und Informationen – so kühn sein kann zu glauben, daß man die
Devisenbewirtschaftung abschaffen könnte, ehe auch dieses Problem gelöst ist. Sie wissen, daß wir nach den OEEC-Vereinbarungen grundsätzlich zur
Wiederaufnahme des Transfers von Dividenden, Zinsen und Gewinnen verpflichtet sind, und wir wurden auf Grund unserer Gläubiger-Position in
letzter Zeit wiederholt an die Erfüllung dieser Verpflichtung gemahnt, d. h. wir müssen sie neben dem Londoner Schuldendienst, neben den
Sachlieferungen an Israel erfüllen, die – wie wir gehört haben – mit Transfer nichts zu tun haben.
Ich komme nun, wenn ich Ihre Geduld noch etwas in Anspruch nehmen darf, auf einige im Zusammenhang mit der Schuldenregelung stehende
Probleme. In London ist auch die Frage des Goldes, das heißt der Goldverpflichtungen, geregelt worden. Es gibt eine Reihe von Fremdwährungsanleihen, die mit Goldklauseln ausgestattet waren. Man hat
eine Lösung gefunden, wonach an Stelle des höheren Goldwertes der Wert des Dollars tritt, der bekanntlich in den 30er Jahren um 40,6% gegenüber
dem Gold abgewertet wurde. Es gibt eine Ausnahme: in den Fällen, in denen von Gold-sfrs die Rede ist, tritt der Schweizer Franken auf die Basis
des heutigen Dollar-Gegenwertes – auch hier wiederum mit einer Ausnahme, nämlich bei der Young-Anleihe, bei der die Schweizer eine Sonderkonzession gemacht haben. Die Goldfrage hat noch eine Bedeutung
im Zusammenhang mit Goldmark- und RM-Schulden mit Goldklausel. Es ist vorgesehen, daß in diesen Fällen eine Erfüllung nicht 10:1, sondern 1:1, d.
h. 1 RM = 1 DM erfolgt, sofern es sich um Anleihen oder Kredite mit spezifisch ausländischem Charakter handelt. Andernfalls soll es bei der
Umstellung 10:1 bleiben. Eine Goldmark in DM umgerechnet würde etwa 1,72 DM entsprechen.
Hier ergibt sich ein weiterer Punkt, den ich erwähnen möchte. Die
Mitglieder der Vereinten Nationen haben ein Einspruchsrecht gegen die im Währungsgesetz vorgesehene Umstellung von RM-Forderungen auf DM im
Verhältnis 10:1. Das scheidet bei Banken aus, aber bei sonstigen Schuldverhältnissen hat es Gültigkeit. Dieses Einspruchsrecht fand
Widerspruch bei den Schweizern, die nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, aber für sich verlangten, daß sie ebenso behandelt würden wie die
Mitglieder der Vereinten Nationen. Das ist eine der »Konzessionen«, die wir gemacht haben. Denn alle erhalten Inländerbehandlung und haben damit den Widerspruch aufgegeben: es erfolgt die Umstellung 10:1.
Ein weiteres Abkommen von Bedeutung ist die Schweizer Regelung. Hier
handelt es sich um die berühmte Schweizer Clearing-Milliarde – eine Forderung, die hauptsächlich in der Kriegszeit entstanden ist. Tatsächlich
war diese Forderung höher als eine Milliarde. Nur hatte es die Schweiz im Kriege aus politischen Gründen vermieden, das Konto höher als auf diese
Summe ansteigen zu lassen und hat sich daher neben dem Reich andere deutsche Schuldner gesucht, obwohl der Erlös der Vorschüsse dem Deutschen Reich zur Verfügung gestellt wurde, so daß die tatsächliche
Clearing-Milliarde ungefähr 1,2 Milliarden sfrs ausmacht. Diese Summe ist reduziert worden auf 650 Millionen sfrs, und die Rückzahlung der Differenz,
auch im Falle der Wiedervereinigung, wird seitens der Schweiz nicht mehr erwogen. Diese 650 Millionen sollen aus einem Teil des Erlöses des nun von
der Schweiz freizugebenden deutschen Vermögens abgebaut werden. Sie wissen, daß die Schweiz im Jahre 1946 das Washingtoner Abkommen getroffen hat, wonach das schon im Februar 1945 von der Schweiz
beschlagnahmte deutsche Vermögen zum wesentlichen Teil den Alliierten überantwortet wurde. Die Schweiz hat damals sogenanntes »Raubgold« im
Ausmaß von 250 Millionen sfrs an die Alliierten zurückgeben müssen; das ist Gold, das während des Krieges von Deutschland in der Schweiz
umgewechselt wurde. Für diesen Betrag hat die Schweiz nicht aus dem Vermögen Erholung gesucht, wie es im Gegensatz zur Schweiz das Land Schweden getan hat. Von dem freigegebenen Vermögen sollen die
kleineren Beträge dem Eigentümer zurückgegeben und dann 1/3 den Alliierten für Reparationszwecke ausgezahlt werden. Im Zusammenhang
hiermit erhält die Schweiz einen Transfer von 121,5 Millionen sfrs. Damit wird sich die Schweizer Regelung von 650 Millionen sfrs auf 528 Millionen
reduzieren; diese sollen im Laufe der nächsten 31 Jahre verzinst und amortisiert werden, und daraus sollen auch in einem Umfang von 200 Millionen DM zugunsten der deutschen Wirtschaft Investitionskredite
gegeben werden. Wie kann man dem Schuldner Kredite geben? Das ist ganz ähnlich, wie die Schweiz es fertiggebracht hat, sich im Kriege
Schuldner zu suchen, ohne ihnen die Darlehensvaluta auszuzahlen. Es ist Sache des Deutschen Reiches, sprich: der Bundesrepublik, die Beträge zu
beschaffen und damit an diejenigen Investitionskredite zu geben, die dann ihre Schuld der Schweiz gegenüber einräumen. Damit ist auch der in London
lange ausgeklammerte Teil der Schuldenregelung, nämlich die sfrs- und die Clearing-Schulden, geregelt worden.
Abschließend darf ich wiederholen, daß im November/Dezember 1952 in
London mit den drei Mächten England, Frankreich und USA grundsätzliche Einigung über das alle von mir genannten Gläubiger-Schuldner-Abkommen
umfassende und verankernde zwischenstaatliche Abkommen erzielt wurde, in dem vor allem allgemein gültige Bestimmungen für alle Schuldenkategorien, wie Gläubiger- und Schuldnerbeitritt, Eröffnung des
Rechtsweges gegen nichtzahlende Schuldner, Fragen der Verjährung, Schiedsgerichtsangelegenheiten u. a. m. enthalten sind. Das zwischenstaatliche Abkommen muß nun noch den übrigen Gläubigerstaaten
zur Stellungnahme vorgelegt werden. Danach erfolgt die Unterzeichnung und abschließend die Ratifizierung durch die Parlamente, soweit dies in den einzelnen Staaten erforderlich ist.
(*) Zusammenfassende Darstellung aus Vorträgen, gehalten in der Zeit vom 11. September bis 26. November 1952.

|